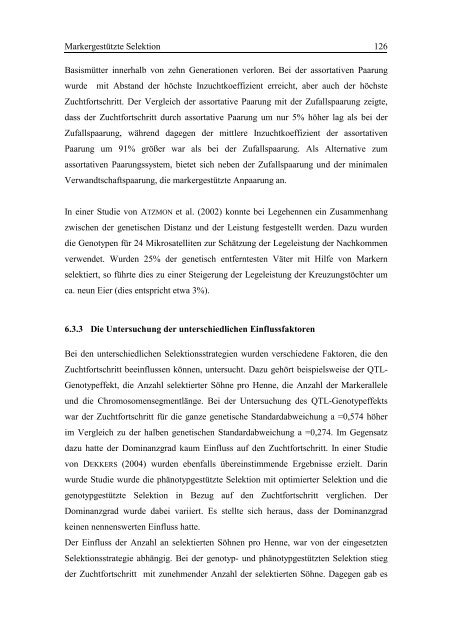tsehay.pdf
tsehay.pdf
tsehay.pdf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Markergestützte Selektion 126<br />
Basismütter innerhalb von zehn Generationen verloren. Bei der assortativen Paarung<br />
wurde mit Abstand der höchste Inzuchtkoeffizient erreicht, aber auch der höchste<br />
Zuchtfortschritt. Der Vergleich der assortative Paarung mit der Zufallspaarung zeigte,<br />
dass der Zuchtfortschritt durch assortative Paarung um nur 5% höher lag als bei der<br />
Zufallspaarung, während dagegen der mittlere Inzuchtkoeffizient der assortativen<br />
Paarung um 91% größer war als bei der Zufallspaarung. Als Alternative zum<br />
assortativen Paarungssystem, bietet sich neben der Zufallspaarung und der minimalen<br />
Verwandtschaftspaarung, die markergestützte Anpaarung an.<br />
In einer Studie von ATZMON et al. (2002) konnte bei Legehennen ein Zusammenhang<br />
zwischen der genetischen Distanz und der Leistung festgestellt werden. Dazu wurden<br />
die Genotypen für 24 Mikrosatelliten zur Schätzung der Legeleistung der Nachkommen<br />
verwendet. Wurden 25% der genetisch entferntesten Väter mit Hilfe von Markern<br />
selektiert, so führte dies zu einer Steigerung der Legeleistung der Kreuzungstöchter um<br />
ca. neun Eier (dies entspricht etwa 3%).<br />
6.3.3 Die Untersuchung der unterschiedlichen Einflussfaktoren<br />
Bei den unterschiedlichen Selektionsstrategien wurden verschiedene Faktoren, die den<br />
Zuchtfortschritt beeinflussen können, untersucht. Dazu gehört beispielsweise der QTL-<br />
Genotypeffekt, die Anzahl selektierter Söhne pro Henne, die Anzahl der Markerallele<br />
und die Chromosomensegmentlänge. Bei der Untersuchung des QTL-Genotypeffekts<br />
war der Zuchtfortschritt für die ganze genetische Standardabweichung a =0,574 höher<br />
im Vergleich zu der halben genetischen Standardabweichung a =0,274. Im Gegensatz<br />
dazu hatte der Dominanzgrad kaum Einfluss auf den Zuchtfortschritt. In einer Studie<br />
von DEKKERS (2004) wurden ebenfalls übereinstimmende Ergebnisse erzielt. Darin<br />
wurde Studie wurde die phänotypgestützte Selektion mit optimierter Selektion und die<br />
genotypgestützte Selektion in Bezug auf den Zuchtfortschritt verglichen. Der<br />
Dominanzgrad wurde dabei variiert. Es stellte sich heraus, dass der Dominanzgrad<br />
keinen nennenswerten Einfluss hatte.<br />
Der Einfluss der Anzahl an selektierten Söhnen pro Henne, war von der eingesetzten<br />
Selektionsstrategie abhängig. Bei der genotyp- und phänotypgestützten Selektion stieg<br />
der Zuchtfortschritt mit zunehmender Anzahl der selektierten Söhne. Dagegen gab es