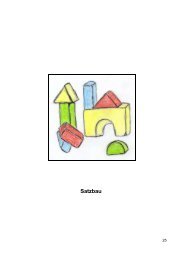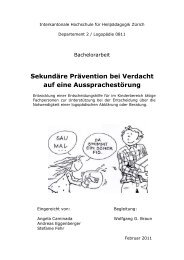BATH SprachverständnisKompass - HfH - Interkantonale ...
BATH SprachverständnisKompass - HfH - Interkantonale ...
BATH SprachverständnisKompass - HfH - Interkantonale ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 12 -<br />
Theoretische Grundlagen<br />
Die Meilensteine werden aufgrund der Lesbarkeit grob in die Kategorien „Kleinkind“, „Vor-<br />
schulkind“ und „Schulkind“ eingeteilt.<br />
Das Kleinkind<br />
Ein erstes Sprachverständnis entwickelt sich zwischen fünf und acht Monaten. In dieser Zeit<br />
beginnt das Kind, den akustischen Input mit einem Gegenstand zu verknüpfen, ohne aber<br />
dessen Bedeutung zu verstehen. Im Alter von neun bis zwölf Monaten werden erste situationsbezogene<br />
Äusserungen verstanden. Das Kind beginnt, das von der Mutter Gesagte mit<br />
einem Gegenstand oder einer Handlung zu verbinden. Unterstützend dabei wirkt der referentielle<br />
Blickkontakt, welcher sich in dieser Zeit das erste Mal zeigt. Das Triangulieren ist eine<br />
Voraussetzung für ein gutes Sprachverständnis. Das Kind schaut auf einen Gegenstand und<br />
wendet den Blick dann zur Mutter, welche den Gegenstand benennt. Zum Beispiel schüttelt<br />
das Kind die Rassel und schaut dann voller Erwartung zur Mutter, die sagt: „Oh schön,<br />
schüttelst du die Rassel? Macht die Rassel ein lustiges Geräusch?“. Drei Grundbedingungen<br />
müssen beim Aufbau des referentiellen Blickkontaktes erfüllt sein: „… a) das Kind interessiert<br />
sich für den Gegenstand bzw. die entsprechende Handlung; b) es interessiert sich für<br />
die Reaktion anderer bzw. deren Kommentar und c) es kann die beiden Interessen verbinden<br />
und integrieren“ (Zollinger, 1994, S. 112). Durch diesen Blickkontakt ist ein erstes lexikalisches<br />
Sprachverständnis möglich. Das erste Wortverständnis erwirbt das Kind mit zwölf<br />
Monaten. Dabei bezieht sich das Verstandene meist auf Handlungs- oder Gegenstandswörter.<br />
Das Kind orientiert sich stark an semantischen Einheiten. Daher wird es auf die Äusserung<br />
„Wirf die Tasse.“ so reagieren, dass es aus der Tasse trinkt, da ihm diese Handlung<br />
bekannt ist („Tu was du normalerweise in dieser Situation tust“). Ebenfalls am Ende des ersten<br />
Lebensjahres beginnt der Individuationsprozess. Das Kind versteht allmählich, dass es<br />
und die Mutter unterschiedliche Individuen sind, welche auch verschiedene Absichten haben<br />
und diese durch die Sprache ausdrücken können. Ab dem 15. Lebensmonat können nun<br />
mehrere Einheiten einer situationsbezogenen Äusserung verstanden, jedoch noch nicht verknüpft<br />
werden. Auf den vorherigen Satz „Wirf die Tasse.“ wird das Kind nun entweder einen<br />
Ball werfen oder aus der Tasse trinken. Es verknüpft nun den Gegenstand mit seiner Funktion,<br />
die Handlung wird durch den Gegenstand definiert. In dieser Phase kann man auch das<br />
Funktionsspiel beobachten. Ebenfalls durch die Weiterentwicklung der Individuation beginnt<br />
das Kind in diesem Alter „Nein“ zu sagen. Zwischen 15 und 18 Monaten werden situative<br />
Aufforderungen – wenn die benannten Gegenstände in der Situation vorhanden sind – verstanden<br />
und ausgeführt.<br />
Zollinger (2008a) sagt: „Die wichtigste Phase der Sprachverständnisentwicklung erreicht das<br />
Kind gegen Ende der sensomotorischen Periode und mit dem Höhepunkt des Individuationsprozesses,<br />
d.h. zwischen 18 und 24 Monaten“ (S. 71). In diesem Lebensabschnitt ent-