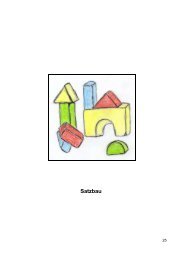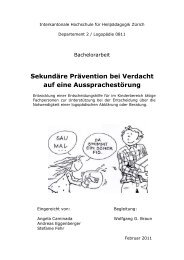BATH SprachverständnisKompass - HfH - Interkantonale ...
BATH SprachverständnisKompass - HfH - Interkantonale ...
BATH SprachverständnisKompass - HfH - Interkantonale ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1 Einleitung<br />
- 4 -<br />
Einleitung<br />
Die Bedeutsamkeit des Sprachverständnisses für die Gesamtentwicklung des Kindes wird<br />
von diversen Autoren und Fachpersonen mehrfach bestätigt. So meint Mathieu (2000):<br />
Das Sprachverständnis steht in engem Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung des Kindes.<br />
Das Kleinkind macht Erfahrungen mit den Menschen und den Gegenständen. Es bemerkt,<br />
dass die Menschen zu Dingen und Situationen Worte (Klangbilder) sagen und entdeckt,<br />
dass diese Worte etwas mit den Gegenständen zu tun haben. Nach und nach integriert<br />
es diese Erfahrungen und beginnt, die Welt der Menschen mit der Welt der Gegenstände zu<br />
verbinden. (S. 83)<br />
Aus dieser Feststellung ist ersichtlich, welche Bedeutung das Sprachverständnis für ein Kind<br />
hat. Nur durch das Verstehen von Sprache kann es auch lernen, die Welt zu verstehen.<br />
Eine grosse Menge an Erfahrungen und somit auch an Fortschritten werden dem Kind durch<br />
fehlendes Sprachverständnis verwehrt. Entgegen der offensichtlichen Bedeutsamkeit des<br />
Sprachverständnisses nahm es in der Forschung und der Praxis lange Zeit einen Platz hinter<br />
der Sprachproduktion ein. Auch heute werden viele Kinder nicht auf das Sprachverständnis<br />
abgeklärt und der Beobachtung und Behandlung des Sprachverständnisses wird nicht in<br />
gleichem Masse Rechnung getragen wie der Sprachproduktion (vgl. Mathieu, 2000).<br />
Elben (2002) bestätigt dies:<br />
In der Beschreibung und Erforschung der kindlichen Sprachentwicklung wurde lange Zeit der<br />
Sprachproduktion der Vorrang gegeben. Gerade in der frühen sprachlichen Entwicklung standen<br />
die ersten produzierten Wörter und Sätze im Mittelpunkt des Interesses, nur geringe Beachtung<br />
erhielt das, was das Kind sprachlich verstehen konnte. (S. 1)<br />
Es stellt sich die Frage, wie dieses Defizit in der Forschung, Beobachtung und Behandlung<br />
zustande gekommen ist. Zollinger (2007) klärt diese Fragestellung grösstenteils mit der<br />
Feststellung, dass das Sprachverständnis und damit auch dessen Störungen als solche nie<br />
direkt beobachtbar sind. Ein weiterer Grund dafür kann nach Zollinger (2008a) die Unsicherheit<br />
darüber sein, was das Sprachverständnis genau ist und wo es einzuordnen ist (s. Kapitel<br />
2.1). Sie betont zudem: „Der Hauptgrund, dass das Sprachverständnis übersehen oder<br />
überhört wird, liegt wahrscheinlich in der Tatsache, dass es weder gesehen noch gehört<br />
werden kann: das Sprachverständnis ist nicht beobachtbar!“ (Zollinger, 2008a, S. 65). Auch<br />
Gebhard (2008) meint:<br />
Die rezeptive Seite des Sprachverhaltens – und damit auch deren Störungen – wurde ganz im<br />
Gegensatz zur expressiven Seite wohl deshalb, weil sie keine direkt beobachtbaren Aktivitäten<br />
bedingt, über lange Jahre als passives Geschehen betrachtet; ein treffender Beleg dafür<br />
ist hier etwa der Begriff des ‚passiven Wortschatzes‘. (S. 8)