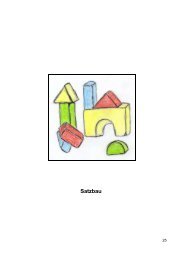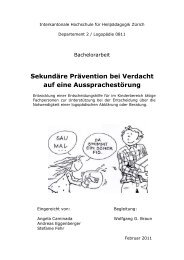BATH SprachverständnisKompass - HfH - Interkantonale ...
BATH SprachverständnisKompass - HfH - Interkantonale ...
BATH SprachverständnisKompass - HfH - Interkantonale ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Rückzug und ängstliches<br />
Verhalten<br />
IV<br />
Anhang<br />
Da sie immer wieder im Alltag mit Missverständnissen<br />
und Unklarheiten konfrontiert werden, werden sie<br />
unsicher. Beispielsweise können sie von anderen<br />
Kindern durch unpassende Antworten ausgelacht<br />
werden und können mit Rückzug reagieren.<br />
Lautes und aggressives Verhalten Die Kinder verhalten sich eher laut und aggressiv. Die<br />
Kinder merken durch Missverständnisse, fragende und<br />
skeptische Blicke der anderen, dass etwas nicht<br />
stimmt. Daher können sie verunsichert werden und<br />
verhalten sich laut, aggressiv und können die Rolle<br />
des Kasperles übernehmen.<br />
Stereotypisches und sprunghaftes<br />
Spielverhalten<br />
Ziellose Spielhandlungen ohne<br />
ersichtlichen Spielverlauf<br />
Bevorzugung des Einzelspiels<br />
Spielen in endlosen, monotonen<br />
Spielsequenzen<br />
„Besonders junge Kinder mit Sprachverständnisstörungen<br />
zeigen stereotypisches Spielverhalten. Oft<br />
fällt nur eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne bei<br />
Situationen oder Spielen auf, die Sprache erfordern…“<br />
(Amorosa & Noterdaeme, 2003, S.11).<br />
Spielhandlungen erscheinen ziellos und es ist kein<br />
richtiger Spielverlauf ersichtlich. Da dem Spiel keine<br />
Bedeutung gegeben wird und die Kinder nicht<br />
entdecken, dass sie mit ihrem Tun die Umwelt verändern,<br />
sind sie auf die Durchführung der Handlung<br />
interessiert und nicht auf den Zweck der Handlung.<br />
„Viele Kinder tendieren noch im Kindergartenalter<br />
dazu, sich vor allem auf die Handlung selbst und kaum<br />
auf deren Resultat zu konzentrieren“ (Zollinger, 1994,<br />
S. 117).<br />
Die Kinder spielen im Freispiel lieber alleine und<br />
können sich nur schwer auf Spielvorschläge des<br />
Partners einlassen. „Allein spielen bedeutet, sich nicht<br />
auf ein Spiel mit anderen Kinder einlassen zu müssen.<br />
Zusammen spielen heisst immer, sich gegenseitig<br />
Ideen mitzuteilen, die unterschiedlichen Vorstellungen<br />
sprachlich auseinander zu setzen und so das<br />
kommende Spiel gemeinsam zu planen. Ein Gespräch<br />
zur Spielplanung kann nur geführt werden, wenn man<br />
versteht, was einem das Gegenüber mitteilen will, und<br />
man seine eigenen Vorstellungen kompetent verteidigen<br />
kann“ (Mathieu, 2008a, S. 47).<br />
Sie verlieren sich in endlosen und monotonen Spielsequenzen.<br />
Die Wahl des Spiels fällt meist immer<br />
gleich aus und die Kinder können sich sehr lange mit<br />
dem gleichen Spiel beschäftigen und vertiefen sich.<br />
Altersabhängige Symptome<br />
Kleinkinder (bis 3;0 Jahre)<br />
Wenig Reaktion auf Sprache „Wenn das Kind im zweiten Lebensjahr nicht auf<br />
Sprache reagiert oder der trianguläre Blickkontakt …<br />
ausbleibt, kann dies ein möglicher Ausdruck von einer<br />
Sprachverständnisentwicklungsverzögerung sein“<br />
(Mathieu, 2008a, S. 46).