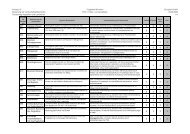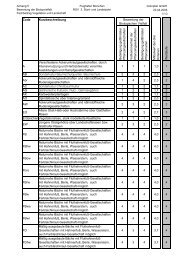Univ.-Prof. Dr. med. Klaus Scheuch Amselgrund 60 01728 ... - DFLD
Univ.-Prof. Dr. med. Klaus Scheuch Amselgrund 60 01728 ... - DFLD
Univ.-Prof. Dr. med. Klaus Scheuch Amselgrund 60 01728 ... - DFLD
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Lärm<strong>med</strong>izinisches Gutachten Flughafen Kassel-Calden<br />
Neben den Kriterien für den Nachweis von negativen Schallwirkungen in der Nacht<br />
spielt auch in der Diskussion die Art der akustischen Kriterien für Begrenzungswerte<br />
für die Nacht, Maximalpegel oder energieäquivalente Dauerschallpegel, eine<br />
wesentliche Rolle. Zunehmend geht man von der Maximalpegelhäufigkeit als<br />
Kriterium aus. Dies ist grundsätzlich zu unterstützen, da in der<br />
Lärmwirkungsforschung überwiegend die Auffassung besteht, dass die Maximalpegel<br />
insbesondere für das Aufwachen, aber auch für andere Effekte in der Nacht eine<br />
größere Bedeutung haben. Dies wurde auch durch die multidisziplinäre Studie im<br />
Deutschen Luft- und Raumfahrtszentrum (BASNER et al. 2001 und 2004)<br />
unterstrichen, in der bei insgesamt 128 Probanden in je 13 aufeinander folgenden<br />
Nächten im Labor mit Maximalpegeln zwischen 50 und 80 dB(A) sowie äquivalenten<br />
Dauerschallpegeln zwischen 31,2 und 52,6 dB(A) keine wesentliche Abhängigkeit<br />
von den Dauerschallpegeln der nächtlichen Reaktionen, sondern nur von der<br />
Maximalpegelhäufigkeit beschrieben wurde. Dies wurde auch in den<br />
Felduntersuchungen aus der gleichen Einrichtung nachgewiesen.<br />
Die Ergebnisse des Projektes „Leiser Flugverkehr“ (SAMEL et al. 2004) bestätigten<br />
den erheblichen Unterschied der Wirkungen von Lärm in den üblichen<br />
Wohnbereichen gegenüber Laboruntersuchungen, den bereits PEARSON (1998)<br />
und andere beschrieben. Bisher wurden in der Lärmwirkungsforschung hauptsächlich<br />
Laborergebnisse für die Ableitung von Begrenzungswerten verwendet. So zeigten<br />
sich in der DLR-Studie im Labor Aufwachwahrscheinlichkeiten bei Maximalpegeln<br />
von 45 dB(A) und 80 dB(A) von 13,3 % bzw. 71,5 %, im Feld (im Schlafzimmer) bei<br />
Maximalpegeln von 27,1 dB(A) und 73,2 dB(A) dagegen<br />
Aufwachwahrscheinlichkeiten von 7,7 % bzw. 18,4 %. In der normalen<br />
Wohnumgebung verläuft die Beziehung von Aufwachwahrscheinlichkeit und auch<br />
anderen Wirkungen des Lärms zu den Schallpegeln erheblich flacher. Dies<br />
unterstreicht die erheblichen Gewöhnungsprozesse, die in gewohnten Umgebungen<br />
ablaufen, weshalb auch der Nachweis von langfristigen Wirkungen schwierig ist. In<br />
den vorläufigen Informationen des DLR-Projektes „Leiser Flugverkehr“ wird von<br />
einem Hintergrundpegel mit 27,1 dB(A) ausgegangen, was dem in der Feldstudie<br />
gefundenen Median entspricht. Bei Maximalpegeln von 27,1 dB(A) wurde trotzdem<br />
66