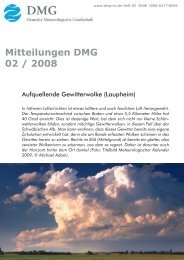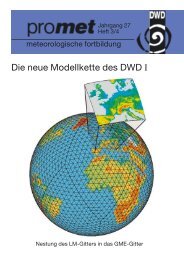Proceedings zur 6. Fachtagung BIOMET - Deutsche ...
Proceedings zur 6. Fachtagung BIOMET - Deutsche ...
Proceedings zur 6. Fachtagung BIOMET - Deutsche ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
schen Gesellschaft findet man von 1864 bis ca. 1875 phänologische Daten. Der Bernische<br />
Forstdienst errichtete ein Waldphänonetz, deren Daten zwischen von 1869 – 1882 vorhanden<br />
sind und ausgewertet wurden (VASSELLA, 1997). Die älteste in der Schweiz bekannte phänologische<br />
Zeitreihe stammt aus Genf. Seit 1808 wird in der Stadt Genf der Blattausbruch der<br />
Rosskastanie beobachtet und notiert. Dieses Ereignis bedeutet für Genf der Frühlingsbeginn.<br />
Als im Oktober 2006 diese Rosskastanie stellenweise nochmals blühte und ihre Blätter entfaltete,<br />
wusste man nicht so recht, ob dies bereits der Frühlingsbeginn 2007 ist. In Liestal wird<br />
seit 1894 die Blüte der Kirschen beobachtet. Beide phänologischen Zeitreihen zeigen einen<br />
deutlichen Trend zu immer früheren Eintrittsterminen. Somit hat die Schweiz auch sehr lange<br />
phänologische Zeitreihen, wenn sie auch nicht soweit <strong>zur</strong>ückreichen wie die Zeitreihe der<br />
Blüte in Japan.<br />
2. Das phänologische Beobachtungsnetz der MeteoSchweiz<br />
1951 gründete der damalige Leiter der Agrarmeteorologie der Meteorologischen Zentralanstalt<br />
(MZA), Bernard Primault, das erste offizielle phänologische Beobachtungsnetz in der<br />
Schweiz, das nach einigen Anpassungen noch heute in Betrieb ist. Mit den phänologischen<br />
Daten wollte man der Landwirtschaft möglichst viele Informationen über die Vegetationsentwicklung<br />
<strong>zur</strong> Verfügung stellen. Von anfänglich etwa 70 phänologischen Beobachtungsstationen<br />
ist das Netz heute auf rund 160 Stationen angewachsen, die alle Regionen der<br />
Schweiz abdecken und von 200 m/M bis 1800 m/M reichen.<br />
Abb. 1: Das phänologische Beobachtungsnetz der Schweiz (MeteoSchweiz)<br />
Fig. 1: Phenological Network of Switzerland (MeteoSwiss)<br />
Von den 1951gegründeten Beobachtungsstationen sind heute noch 17 in Betrieb, die lückenlos<br />
Daten lieferten. Das Beobachtungsprogramm von 1951 umfasste 9 Kräuter, 15 Bäume/Sträucher,<br />
12 Kulturpflanzen und drei Zugvögel sowie der erste Reif im Herbst. Bereits<br />
1953 wurde das Beobachtungsformular neu gestaltet. Die Namen der Pflanzen wurden im<br />
selben Formular in drei Sprachen (französisch, deutsch und italienisch) angegeben. 1996 wurde<br />
das phänologische Beobachtungsprogramm überarbeitet. Aufgrund von ausführlichen<br />
Auswertungen (DEFILA, 1991) wurden einige Pflanzen und Phänophasen nicht mehr ins Programm<br />
aufgenommen, da die Qualität der Daten ungenügend war. Da die Landwirtschaft an<br />
den Daten der Kulturpflanzen nicht interessiert war, und die Vogelwarte Sempach genügend<br />
219