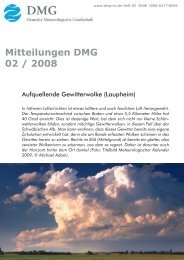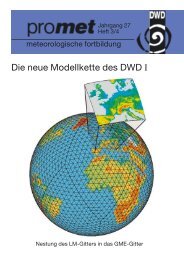Proceedings zur 6. Fachtagung BIOMET - Deutsche ...
Proceedings zur 6. Fachtagung BIOMET - Deutsche ...
Proceedings zur 6. Fachtagung BIOMET - Deutsche ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Daten über Vogelzüge besass, wurde beschlossen, die Anzahl Kulturpflanzen stark zu reduzieren<br />
und die Vogelphänologie ganz wegzulassen. Bis 1986 waren alle Daten nur auf Papier<br />
vorhanden, und so mussten alle Daten elektronisch <strong>zur</strong>ückerfasst werden. Mitte der Neunzigerjahre<br />
erlebte die Phänologie weltweit „dank“ der Klimaerwärmung einen starken Aufschwung.<br />
In verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten konnte nachwiesen werden, dass infolge<br />
der allgemeinen Erwärmung die phänologischen Eintrittstermine (vor allem im Frühling)<br />
einen Trend zu früheren Terminen aufweisen. Somit lag nun der Fokus beim neuen Beobachtungsprogramm<br />
bei der Beibehaltung von möglichst vielen gut beobachtbaren Phänophasen<br />
und langen Beobachtungsreihen. Für die Auswertung von langen phänologischen<br />
Zeitreihen eignen sich die Kulturpflanzen schlecht, da in der Pflanzenzüchtung, Anbaumethode,<br />
Düngung, Schädlingsbekämpfung etc. in der Landwirtschaft sich in den letzten Jahrzehnten<br />
sehr viel verändert hat. So enthält das aktualisierte Programm 26 Pflanzenarten und<br />
69 Phänophasen. Es handelt sich dabei um 14 wild wachsende Bäume/Sträucher, 8 Kräuter<br />
und 4 Kulturpflanzen. Die Beobachtungsblätter werden dem Bundesamt für Meteorologie und<br />
Klimatologie MeteoSchweiz einmal pro Jahr nach Ende der Vegetationsperiode zugesandt,<br />
und die Daten werden danach elektronisch erfasst. Nun möchte die Bevölkerung oder die<br />
Presse auch während der Vegetationsperiode über den Stand der Vegetationsentwicklung orientiert<br />
sein. Insbesondere interessieren besonders frühe oder späte Jahre. Deshalb wurde 1986<br />
ein Sofortmeldenetz und –programm eingeführt. Aus den 160 Beobachtungsstationen wurden<br />
40 ausgewählt, die über möglichst lange Beobachtungsreihen verfügen und die verschiedenen<br />
Regionen und Höhenlagen abdecken. Es wurden 17 Phänophasen, die sich über die ganze<br />
Vegetationsperiode (von der Blüte der Hasel bis <strong>zur</strong> Blattverfärbung der Buche) erstrecken,<br />
ausgewählt und deren Eintrittstermine werden sofort der MeteoSchweiz gemeldet. Mit einer<br />
speziellen Statistik werden die Daten pro Phänophase und Station in fünf Klassen von sehr<br />
früh, früh, normal, spät bis sehr spät eingeteilt. Aufgrund dieser Auswertungen werden während<br />
der Vegetationszeit wöchentlich phänologische Bulletins erstellt und via Internet verbreitet<br />
Wie der Name bereits sagt, sind phänologische Beobachtungen keine Messungen sondern<br />
Beobachtungen und somit in einem gewissen Grad subjektiv. Damit die phänologischen Daten<br />
der verschiedenen Stationen vergleichbar sind, müssen sie aufgrund derselben Kriterien<br />
erhoben werden, das bedeutet, dass die Beobachterinnen und Beobachter eine Anleitung brauchen.<br />
1957 hatte Bernard Primault die erste Anleitung geschrieben. Sie wurde illustriert mit<br />
sehr guten Zeichnungen von S. Schwirzer. Er nannte dieses Buch „Phänologischer Atlas“<br />
(PRIMAULT, 1971). Nach der Änderung des Beobachtungsprogramms 1996 wurde eine neue<br />
Anleitung dringend notwendig. In einer kleinen Arbeitsgruppe, zusammen mit dem Geographischen<br />
Institut der Universität Bern, wurde diese Anleitung erarbeitet. Bald wurde allen<br />
klar, dass nicht nur eine Anleitung für BeobachterInnen entstehen soll sondern ein Werk, das<br />
dem Leserkreis die Phänologie bekannt und näher bringen soll. So entstand das zweisprachige<br />
(deutsch, französisch) Buch mit dem Titel „Pflanzen im Wandel der Jahreszeiten- Anleitung<br />
für phänologische Beobachtungen“ (BRUEGGER und VASSELLA, 2003). Das Buch ist<br />
zweisprachig (deutsch, französisch). Nach einer Einführung in die Phänologie folgen ausführliche<br />
Beobachtungsrichtlinien sowie ein Kapitel über Forschung und Anwendungen der Phänologie.<br />
Von den BeobachterInnen wird diese neue Anleitung sehr geschätzt.<br />
Neben diesem gesamtschweizerischen phänologischen Netz gibt es auch Spezialnetze sowie<br />
regionale Netze wie zum Beispiel Beobachtungen von Phänologischen Stadien an Kulturpflanzen,<br />
die für Frostwarnungen und Schädlingsbekämpfungsmassnahmen dienen. 1970<br />
wurde das Berner Phänologienetz des Geographischen Institutes der Universität Bern gegründet.<br />
Dazu kommen Beobachtungen der Vogelzüge der Vogelwarte Sempach oder Pollenmessungen<br />
der MeteoSchweiz und noch viele Einzelbeobachtungen von interessierten NaturbeobachterInnen.<br />
Auch ein Internationale Phänologischer Garten (IPG) ist bei der For-<br />
220