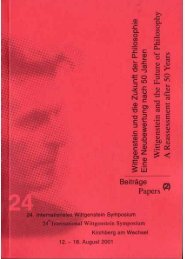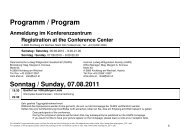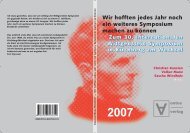Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Wittgenstein</strong> im Iran<br />
Malek Hosseini, Munich, Germany<br />
I. Erste Phase<br />
Die Rezeption <strong>Wittgenstein</strong>s im Iran erfolgte zum<br />
erstenmal gegen Ende 1971, und zwar durch die<br />
Übersetzung des zusammengefassten Vorworts David<br />
Pears zu seinem damals neuerlich erschienenem Buch<br />
<strong>Ludwig</strong> <strong>Wittgenstein</strong>. Der Übersetzer war Manutschehr<br />
Bosorgmehr, der an der Teheraner Universität lehrte.<br />
Dieser veröffentlichte kurz danach, im Jahre 1972, seine<br />
Übersetzung von Justus Hartnacks ursprünglich auf<br />
Dänisch erschienenem <strong>Wittgenstein</strong> and Modern<br />
Philosophy (London 1965). Bosorgmehr war scheinbar ein<br />
Positivist, wahrscheinlich war besonders der frühe<br />
<strong>Wittgenstein</strong> für ihn von Bedeutung; es ist nicht<br />
ausgeschlossen, dass er <strong>Wittgenstein</strong> gezielt und bewusst<br />
im philosophischen Raum Irans vorstellen wollte. Es gab<br />
nämlich auch einen von Martin Heidegger begeisterten<br />
Kreis.<br />
Im gleichen Jahre veröffentlichte Darjusch Aschuri,<br />
ein bekannter Intellektueller, einen Aufsatz mit dem Titel<br />
„<strong>Ludwig</strong> <strong>Wittgenstein</strong>: der leidenschaftliche Logiker“, in<br />
dem er eine für die damalige Zeit Irans gute und<br />
allgemeine Beschreibung von <strong>Wittgenstein</strong> und seinem<br />
Werke gab.<br />
1975 veröffentlichte der hochgelehrte Scharafoddin<br />
Khorasani seine Übersetzung von I. M. J. Bochenskis<br />
Europäische Philosophie der Gegenwart (Bern 1947) mit<br />
einem von dem Übersetzter selbst verfassten Anhang, in<br />
dem er eine auf <strong>Wittgenstein</strong>s eigenen Werken<br />
gegründete Beschreibung der beiden Denkphasen<br />
<strong>Wittgenstein</strong>s auf etwa 25 Seiten gibt Diese Beschreibung<br />
scheint der erste philosophisch ernstzunehmende<br />
ursprünglich auf Persisch geschriebene Text über<br />
<strong>Wittgenstein</strong> zu sein.<br />
1980 erschien von dem späteren Übersetzer des<br />
Tractatus <strong>Wittgenstein</strong>s ins Persische, Mir Schamssoddin<br />
Adib Soltani, ein beachtenswertes Werk mit dem Titel Die<br />
Wiener Abhandlung, in dem er sich freilich auch mit dem<br />
frühen <strong>Wittgenstein</strong> beschäftigt.<br />
Viele Jahre später, 1987, erschien ein Aufsatz von<br />
Schapur Etemad, einem bekannten Akademiker, mit dem<br />
Titel: „<strong>Wittgenstein</strong>: Logik, Mathematik und<br />
Naturwissenschaften in der ‚Logisch-philosophischen<br />
Abhandlung’“.<br />
Abgesehen von manchen Hinweisen in Werken zur<br />
Philosophiegeschichte scheinen das alle Texte zu sein, die<br />
über <strong>Wittgenstein</strong> bis etwa 1990 in persischer Sprache<br />
veröffentlicht wurden.<br />
II. Zweite Phase<br />
1. Hintergrund<br />
Etwa dreizehn Jahre nach der Islamischen Revolution und<br />
drei Jahre nach dem langen Krieg mit dem Iraq, hat der Iran<br />
langsam begonnen, auch in kultureller Hinsicht viele neue<br />
Erfahrungen zu sammeln; trotz aller Schwierigkeiten hat das<br />
Land eine spannende ja in mancher Hinsicht glühende Zeit<br />
vor sich. Die intellektuellen Diskussionen werden heißer, die<br />
philosophisch-theologischen Debatten schärfer. Dabei<br />
werden in verschiedenen Bereichen viele Aufsätze und<br />
Bücher übersetzt und veröffentlicht. Die philosophischen<br />
Werke haben dabei besonderen Stellenwert, und auch<br />
<strong>Wittgenstein</strong> genießt zunehmende Aufmerksamkeit: Nicht<br />
nur Werke von ihm werden veröffentlicht, sondern es<br />
kommen auch allerlei Werke über ihn in persischer Sprache<br />
heraus, wie etwa „Wittgestein für Anfänger“ oder<br />
„<strong>Wittgenstein</strong> in 90 Minuten“ bis zu sehr bedeutsamen<br />
Werken, manche davon mit nicht immer gelungenen<br />
Übersetzungen. Die Zahl persischer Bücher von und über<br />
<strong>Wittgenstein</strong> beträgt gegenwärtig um die 40. (Die wichtigen<br />
Forschungen zu <strong>Wittgenstein</strong> sind jedoch größtenteils nicht<br />
übersetz worden.) Sogar in vielen nicht philosophischen<br />
Pressen kann man über <strong>Wittgenstein</strong> lesen, man könnte<br />
sogar von einem <strong>Wittgenstein</strong>-Fieber reden. Bis zum Jahre<br />
2004 – hauptsächlich in einen Zeitraum von fünf Jahren –<br />
sind nach der Statistik über 100 Aufsätze, einschließlich<br />
Buchbesprechungen, über <strong>Wittgenstein</strong> veröffentlicht<br />
worden, und zwar in verschiedenen Zeitschriften und<br />
Zeitungen (es war ja der „Frühling der Presse“, die Zeit der<br />
„Reformisten“). Man braucht nicht darauf hinzuweisen, dass<br />
manche von diesen Veröffentlichungen kein so hohes<br />
Niveau hatten.<br />
Warum aber solche Aufmerksamkeit gegenüber<br />
<strong>Wittgenstein</strong>? Diese Frage lässt sich nicht leicht<br />
beantworten; vielleicht könnte man sagen, dass sie zum<br />
größten Teil nur ein bloßer Zufall ist. Eines scheint mir<br />
jedoch sicher, und zwar was die ernste Seite dieser<br />
Zuwendung zu <strong>Wittgenstein</strong> betrifft: Bei den erwähnten<br />
theologisch-philosophischen Debatten hatte für viele die<br />
rationale Rechtfertigung der Religion und des religiösen<br />
Glaubens an Gültigkeit verloren. Die „Religiöse Erfahrung“<br />
war wichtig und ist viel diskutiert geworden, der religiöse<br />
Pluralismus wurde von vielen stark verteidigt (da kennt man<br />
nun etwa John Hick sehr gut). Kein Wunder also, dass<br />
<strong>Wittgenstein</strong> gut zu verwenden war. Jedenfalls war die<br />
Aufmerksamkeit gegenüber <strong>Wittgenstein</strong> größten Teils im<br />
Bereich der Philosophie der Religion zu finden. Abhängig<br />
von den theologischen Debatten bekamen auch<br />
erkenntnistheoretischen Themen große Bedeutung; und<br />
auch hier hörte man den Namen <strong>Wittgenstein</strong>.<br />
Obwohl für manche von den sogenannten „religiösen<br />
Intellektuellen“ – die die Modernität verteidigen und<br />
versuchen den Islam und die Werte der Moderne in<br />
Einklang zu bringen – <strong>Wittgenstein</strong> bei den schon erwähnten<br />
Debatten vieles zu sagen hatte, konnte seine zweite<br />
Denkphase für manche von ihnen von keiner Bedeutung<br />
sein, anders als zum Beispiel Karl Popper. Dagegen<br />
konnten manche Gegner der „Religiösen Intellektuellen“,<br />
darunter die Vertreter der Postmoderne, sich auch<br />
<strong>Wittgenstein</strong>s Denken bedienen. Ich möchte mich aber hier<br />
nicht in diese ziemlich komplizierte Angelegenheit vertiefen.<br />
Jedenfalls ist in diesen Jahren <strong>Wittgenstein</strong> auch für die<br />
Iraner mit postmodernistischen Neigungen<br />
verständlicherweise attraktiv gewesen, und diese – seien es<br />
die Religiösen, seien es die Säkularen – haben bei der<br />
zunehmenden Aufmerksamkeit auf ihn mitgewirkt; es hat ja<br />
im Iran auch ein Postmodern-Fieber gegeben!<br />
Ich möchte jedoch nicht alles auf die kurz<br />
beschriebenen Faktoren reduzieren. Für manche ist die<br />
Person <strong>Wittgenstein</strong> interessant und beachtenswert<br />
gewesen, für manche die Beschäftigung mit ihm von bloß<br />
129