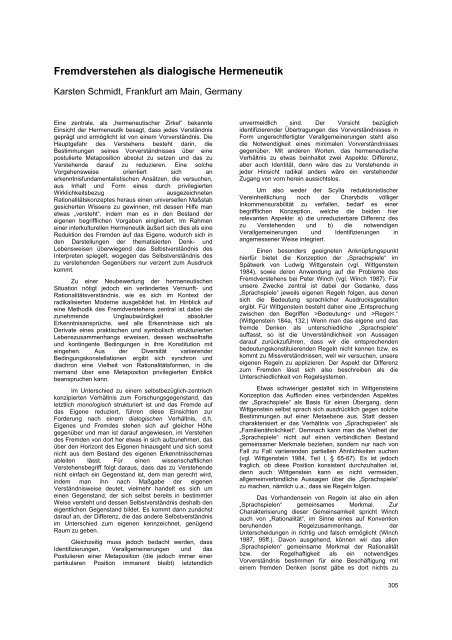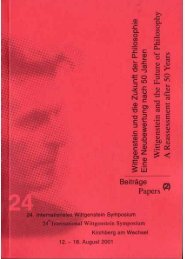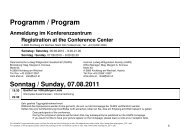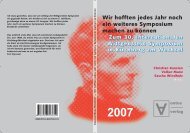Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Fremdverstehen als dialogische Hermeneutik<br />
Karsten Schmidt, Frankfurt am Main, Germany<br />
Eine zentrale, als „hermeneutischer Zirkel“ bekannte<br />
Einsicht der Hermeneutik besagt, dass jedes Verständnis<br />
geprägt und ermöglicht ist von einem Vorverständnis. Die<br />
Hauptgefahr des Verstehens besteht darin, die<br />
Bestimmungen seines Vorverständnisses über eine<br />
postulierte Metaposition absolut zu setzen und das zu<br />
Verstehende darauf zu reduzieren. Eine solche<br />
Vorgehensweise orientiert sich an<br />
erkenntnisfundamentalistischen Ansätzen, die versuchen,<br />
aus Inhalt und Form eines durch privilegierten<br />
Wirklichkeitsbezug ausgezeichneten<br />
Rationalitätskonzeptes heraus einen universellen Maßstab<br />
gesicherten Wissens zu gewinnen, mit dessen Hilfe man<br />
etwas „versteht“, indem man es in den Bestand der<br />
eigenen begrifflichen Vorgaben eingliedert. Im Rahmen<br />
einer interkulturellen Hermeneutik äußert sich dies als eine<br />
Reduktion des Fremden auf das Eigene, wodurch sich in<br />
den Darstellungen der thematisierten Denk- und<br />
Lebensweisen überwiegend das Selbstverständnis des<br />
Interpreten spiegelt, wogegen das Selbstverständnis des<br />
zu verstehenden Gegenübers nur verzerrt zum Ausdruck<br />
kommt.<br />
Zu einer Neubewertung der hermeneutischen<br />
Situation nötigt jedoch ein verändertes Vernunft- und<br />
Rationalitätsverständnis, wie es sich im Kontext der<br />
radikalisierten Moderne ausgebildet hat. Im Hinblick auf<br />
eine Methodik des Fremdverstehens zentral ist dabei die<br />
zunehmende Unglaubwürdigkeit absoluter<br />
Erkenntnisansprüche, weil alle Erkenntnisse sich als<br />
Derivate eines praktischen und symbolisch strukturierten<br />
Lebenszusammenhangs erweisen, dessen wechselhafte<br />
und kontingente Bedingungen in ihre Konstitution mit<br />
eingehen. Aus der Diversität variierender<br />
Bedingungskonstellationen ergibt sich synchron und<br />
diachron eine Vielheit von Rationalitätsformen, in die<br />
niemand über eine Metaposition privilegierten Einblick<br />
beanspruchen kann.<br />
Im Unterschied zu einem selbstbezüglich-zentrisch<br />
konzipierten Verhältnis zum Forschungsgegenstand, das<br />
letztlich monologisch strukturiert ist und das Fremde auf<br />
das Eigene reduziert, führen diese Einsichten zur<br />
Forderung nach einem dialogischen Verhältnis, d.h.<br />
Eigenes und Fremdes stehen sich auf gleicher Höhe<br />
gegenüber und man ist darauf angewiesen, im Verstehen<br />
des Fremden von dort her etwas in sich aufzunehmen, das<br />
über den Horizont des Eigenen hinausgeht und sich somit<br />
nicht aus dem Bestand des eigenen Erkenntnisschemas<br />
ableiten lässt. Für einen wissenschaftlichen<br />
Verstehensbegriff folgt daraus, dass das zu Verstehende<br />
nicht einfach ein Gegenstand ist, dem man gerecht wird,<br />
indem man ihn nach Maßgabe der eigenen<br />
Verständnisweise deutet, vielmehr handelt es sich um<br />
einen Gegenstand, der sich selbst bereits in bestimmter<br />
Weise versteht und dessen Selbstverständnis deshalb den<br />
eigentlichen Gegenstand bildet. Es kommt dann zunächst<br />
darauf an, der Differenz, die das andere Selbstverständnis<br />
im Unterschied zum eigenen kennzeichnet, genügend<br />
Raum zu geben.<br />
Gleichzeitig muss jedoch bedacht werden, dass<br />
Identifizierungen, Verallgemeinerungen und das<br />
Postulieren einer Metaposition (die jedoch immer einer<br />
partikularen Position immanent bleibt) letztendlich<br />
unvermeidlich sind. Der Vorsicht bezüglich<br />
identifizierender Übertragungen des Vorverständnisses in<br />
Form ungerechtfertigter Verallgemeinerungen steht also<br />
die Notwendigkeit eines minimalen Vorverständnisses<br />
gegenüber. Mit anderen Worten, das hermeneutische<br />
Verhältnis zu etwas beinhaltet zwei Aspekte: Differenz,<br />
aber auch Identität, denn wäre das zu Verstehende in<br />
jeder Hinsicht radikal anders wäre ein verstehender<br />
Zugang von vorn herein aussichtslos.<br />
Um also weder der Scylla reduktionistischer<br />
Vereinheitlichung noch der Charybdis völliger<br />
Inkommensurabilität zu verfallen, bedarf es einer<br />
begrifflichen Konzeption, welche die beiden hier<br />
relevanten Aspekte: a) die unreduzierbare Differenz des<br />
zu Verstehenden und b) die notwendigen<br />
Verallgemeinerungen und Identifizierungen in<br />
angemessener Weise integriert.<br />
Einen besonders geeigneten Anknüpfungspunkt<br />
hierfür bietet die Konzeption der „Sprachspiele“ im<br />
Spätwerk von <strong>Ludwig</strong> <strong>Wittgenstein</strong> (vgl. <strong>Wittgenstein</strong><br />
1984), sowie deren Anwendung auf die Probleme des<br />
Fremdverstehens bei Peter Winch (vgl. Winch 1987). Für<br />
unsere Zwecke zentral ist dabei der Gedanke, dass<br />
„Sprachspiele“ jeweils eigenen Regeln folgen, aus denen<br />
sich die Bedeutung sprachlicher Ausdrucksgestalten<br />
ergibt. Für <strong>Wittgenstein</strong> besteht daher eine „Entsprechung<br />
zwischen den Begriffen >Bedeutung< und >Regel