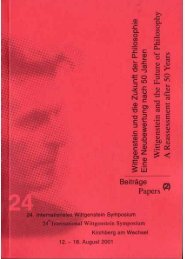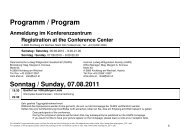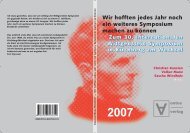Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Auf der Grundlage von <strong>Wittgenstein</strong>s<br />
Sprachspielkonzeption und deren Weiterführung durch die<br />
Unterscheidung verschiedener Arten von Regeln kann der<br />
Prozess des Verstehens fremden Denkens im Sinne einer<br />
dialogischen Hermeneutik nun genauer bestimmt werden.<br />
Das Verhältnis des eigenen zum fremden Denken wurde<br />
beschrieben als die Konfrontation unterschiedlicher<br />
Systeme bedeutungs-konstituierender Regeln. Die<br />
hermeneutische Annäherung an das fremde Denken<br />
besteht darin, die Regeln des anderen „Sprachspiels“ zu<br />
lernen. Dabei muss man von den Regeln der eigenen<br />
Denkweise ausgehen, die das jeweilige Vorverständnis<br />
bilden.<br />
Wie wir sahen, bringt jedes Vorverständnis, das<br />
über die Minimalbestimmung eines hermeneutischen<br />
Gegenstandes hinausgeht, die Gefahr mit sich, das<br />
andere Selbstverständnis durch eigene Anschauungen zu<br />
entstellen. Daher ist es hermeneutisch kontraproduktiv, die<br />
Metaebene von Eigenem und Fremdem über dieses<br />
Minimum (Regelrationalität) hinaus zu bestimmen. In der<br />
konkreten Begegnung ist man allerdings immer schon von<br />
einem weitergehenden Vorverständnis geprägt, denn<br />
letztendlich bildet die eigene Denkweise insgesamt dieses<br />
Vorverständnis und ist daher im Verstehensprozess<br />
unverzichtbar. Man muss also die explizierbaren Aspekte<br />
seiner Denkweise, soweit sie in der Begegnung mit dem<br />
fremden Denken relevant werden, offensiv in den<br />
Verstehensprozess einbringen, ohne sie jedoch dem zu<br />
Verstehenden gegenüber erkenntnisfundamentalistisch<br />
auszuzeichnen und dabei das Fremde auf das Eigene zu<br />
reduzieren. Vielmehr besteht der Prozess des Verstehens<br />
darin, das Eigene auf das Fremde hin zu erweitern. In<br />
dieser Erweiterung liegt das dialogische Moment, denn<br />
man nimmt von dem Fremden etwas in sich auf, das man<br />
nicht (monologisch) aus dem Eigenen abgeleitet hat.<br />
Die erweiterten Regeln, mit denen man sich dem zu<br />
Verstehenden expliziten Selbstverständnis (also Regeln<br />
2b)) annähert, entsprechen auf der eigenen Seite denen<br />
der Kategorie 2a). D.h. man erweitert seinen Horizont des<br />
prinzipiell Verständlichen, bewahrt sich aber innerhalb<br />
dessen einen eigenen Standpunkt, dem das zu<br />
verstehende Denken als ein anderer gegenübersteht,<br />
konstituiert jeweils durch Regeln der Kategorie 2b). Auf<br />
diese Weise bleibt einerseits eine Kritik des anderen<br />
möglich (auf der Grundlage der Regeln des eigenen<br />
Standpunktes), andererseits ist durch ein Verstehen der<br />
fremden Denkweise auch eine intensivierte bzw. vermittelt<br />
durch den externen Standpunkt eines anderen<br />
Selbstverständnisses überhaupt erst eine veritable<br />
Selbstkritik möglich (weil in der reinen Selbstbezüglichkeit<br />
Gegenstand und Vollzugsmedium der Kritik identisch sind<br />
und somit Teile des eigenen Denkens, die man in der<br />
Selbstkritik verwendet, einer Kritik entzogen bleiben).<br />
Eine dialogische Hermeneutikkonzeption auf der<br />
Basis eines durch die genannten Differenzierungen<br />
erweiterten Konzeptes von Regelrationalität kann somit<br />
den beiden größten Gefahren der interkulturellen<br />
Begegnung entgehen: entweder die eigene Sicht der<br />
Dinge normativ absolut zu setzen oder einem<br />
Beliebigkeitspluralismus zu verfallen. Andererseits eröffnet<br />
sie die Möglichkeit, sich auf der Grundlage einer<br />
nichtreduktionistischen Wahrnehmung in der kulturellen<br />
Vielfalt angemessen zu orientieren und dabei kritisch<br />
gegenüber anderem und sich selbst zu sein.<br />
Fremdverstehen als dialogische Hermeneutik - Karsten Schmidt<br />
Literatur:<br />
Ryle, Gilbert 1969 Der Begriff des Geistes, Stuttgart: Reclam<br />
Winch, Peter 1987 Was heißt „eine primitive Gesellschaft<br />
verstehen“?, in: Hans G. Kippenberg und Brigitte Luchesi (eds.),<br />
Magie. Die sozialwissenschaftliche Kontroverse über das<br />
Verstehen fremden Denkens, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 73-119.<br />
<strong>Wittgenstein</strong>, <strong>Ludwig</strong> 1984 Philosophische Untersuchungen, in:<br />
Werkausgabe Bd. 1, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.<br />
<strong>Wittgenstein</strong>, <strong>Ludwig</strong> 1984a Über Gewißheit, in: Werkausgabe Bd.<br />
8, Frankfurt a. M.: Suhrkamp<br />
307