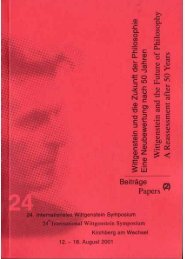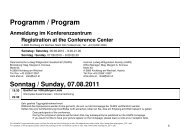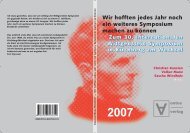Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
einer ausgesprochen lockeren Sprache. Seine<br />
Unterscheidung der drei Welten nennt er "eine<br />
Klassifikation: nichts Besonderes" (ebda S. 99). An<br />
anderer Stelle platziert er sie in den Bereich der<br />
Metaphysik, ohne das jedoch ontologisch zu meinen (ebda<br />
S. 74).<br />
Aber er nimmt natürlich eine gewisse Plausibilität für<br />
kausale Wirkungen von Welt3 in Anspruch, und ich<br />
plädiere dafür, sich dem anzuschließen. Denn, um es mit<br />
Max Planck zu sagen: Der Freiheit des menschlichen<br />
Geistes würde es wenig helfen, sich auf den<br />
Indeterminismus der Quantenmechanik zu berufen. Für<br />
das Geistige im Menschen fordert man ja gerade, daß es<br />
die Welt zu gestalten fähig sei. Jede Zurechenbarkeit von<br />
Handlungen würde sich verflüchtigen, wollte man sich<br />
gegen das Kausalitätsprinzip auf den "blinden Zufall"<br />
berufen (Planck 1990, S. 152; dazu: Hassenstein 1978).<br />
Pluralismus der Sprachspiele und<br />
Inkommensurabilät<br />
Diese Überschrift spielt an auf einen interessanten<br />
Abschnitt in Poppers Objektiver Erkenntnis (Popper 1972,<br />
p. 153). Poppers Abneigung gegen sprachanalytisches<br />
Vorgehen um der "objektiven Probleme" willen führt immer<br />
wieder dazu, daß er auch in Fragen, die man viel besser<br />
sprachanalytisch und methodologisch formulieren könnte,<br />
lieber Anleihen bei der traditionellen Metaphysik und dem<br />
Common Sense macht. So ist es auch mit dem<br />
Pluralismus, den er lieber als einen Pluralismus der Welten<br />
einführt (in dieser Hinsicht zählt er nicht wie die Dualisten<br />
nur bis zwei, sondern unter Berufung auf Platon, die<br />
Stoiker und Moderne wie Leibniz, Frege und Bolzano bis<br />
drei) denn als einen Pluralismus von Sprachen oder<br />
Sprachspielen, die sich gewiß nicht so einfach abzählen<br />
lassen. Fairer Weise wäre allerdings hinzuzufügen, daß<br />
Popper diese Dreizahl nicht abschließend nimmt (vgl.<br />
Popper 1972, p. 106f.).<br />
Wenn ich jetzt zur Ergänzung Poppers und zur<br />
Erläuterung eines unabgeschlossenen Pluralismus der<br />
Vielheit auf ein Kriterium von Paul Feyerabend, nämlich<br />
auf dessen Prinzip der Inkommensurabilität (Feyerabend<br />
1977, S. 310ff.), zurückgreife, so geschieht das nicht ohne<br />
eine gewisse Pikanterie. War doch Feyerabend (1981, S.<br />
326 – 364) einer der ersten und schärfsten Kritiker der<br />
Welt3 Poppers, welche er einer vernichtenden Kritik<br />
unterzog. Andererseits fand er später Gefallen daran,<br />
selbst die Regentänze der Hopis für kosmologisch möglich<br />
zu erklären (1977, S. 78ff.). Da halte ich mich doch lieber<br />
zunächst an die Befolgung der Straßenverkehrsordnung<br />
und deren Auswirkung auf das Parken von Autos.<br />
Inspiriert von <strong>Wittgenstein</strong>s Sprachspielkonzept hat<br />
Paul Feyabend (1977, 1980, 1981; dazu: Duerr (ed.) 1980,<br />
1981) für einen offenen Pluralismus der Sprachspiele eine<br />
etwas schärfere Begrifflichkeit entwickelt, als man sie<br />
hierzu bei Popper findet. Feyerabend fordert zu einer<br />
methodologischen Selbstreflexion in dem Sinne auf, dass<br />
man "die Gehaltsklassen gewisser Theorien" (also<br />
Poppers Inhalte der Bücher) daraufhin untersucht, welche<br />
der "üblichen logischen Beziehungen (Einschließung,<br />
Ausschließung, Überschneidung) zwischen ihnen gilt"<br />
(1977, S. 310). Sein Ergebnis: In den allermeisten Fällen,<br />
in denen moderne Wissenschaft und Metaphysik<br />
aufeinander treffen, werde man finden, dass die<br />
Reichweite der modernen Theorien, an deren eigener<br />
Logik gemessen, gar nicht zureiche, um die von ihnen aus<br />
oft angegriffene Metaphysik in einem logisch strikten Sinne<br />
"verbieten" zu können. Diesen Sachverhalt nennt er<br />
232<br />
Das Gehirn, das Ich und die Straßenverkehrsordnung - Hermann Oetjens<br />
Inkommensurabilität. Als Beispiel nennt er die<br />
Inkommensurabilität von moderner Physik und Kosmologie<br />
der Hopis, zwischen denen aus rein logischen Gründen<br />
kein echter Widerspruch zu konstruieren sei. Seine<br />
Folgerung: "Wenn man Regentänzen eine Wirkung auf die<br />
Natur abspricht, so gibt es dafür also weder unmittelbare<br />
noch mittelbar empirische Gründe" (aaO S. 79).<br />
Das Feyerabendsche Prinzip der<br />
Inkommensurabilität orientiert sich an den Möglichkeiten<br />
deduktiver Logik, die sich bekanntlich auch der Kritische<br />
Rationalismus Poppers zum Leitfaden erkoren hat. Indem<br />
Feyerabend den Kritischen Rationalismus in diesem Sinne<br />
gewissermaßen beim Wort nimmt, zeigt er, dass, je<br />
konsequenter sich die an der Logik der deduktiven<br />
Überprüfung orientierte Rationalität sich auf eben dieses<br />
Argumentationswerkzeug besinnt, sie sich eigentlich desto<br />
weitherziger und toleranter gegenüber alternativen<br />
Weltauffassungen gebärden müßte, die sich gemäß der<br />
Inkommensurabilität außerhalb ihrer logischen Reichweite<br />
bewegen.<br />
Statt "alles geht": Ignoramus<br />
Zu dem bekannten "anything goes" Feyerabends wäre<br />
anmerken, daß man dieses "alles geht" natürlich nicht<br />
positiv in dem Sinne verstehen darf, daß etwa dadurch die<br />
Regentänze der Hopis und der mit ihnen verbundene<br />
Wirkungsanspruch als legitimiert angesehen werden<br />
könnte. Was man aufgrund der Inkommensurabilität aus<br />
der Warte der modernen Physik nur sagen könnte, wäre<br />
ein achselzuckendes "weiß nicht" oder "mag sein oder<br />
auch nicht", vielleicht auch ein vielsagendes: "möglich"<br />
(dazu: Oetjens 1983).<br />
In diesem Sinne würde das Prinzip der<br />
Inkommensurabilität zu einer Reduzierung des berühmten<br />
"ignoramus et ignorabimus" ("wir wissen es nicht und wir<br />
werden es nicht wissen") des Physiologen Du Bois-<br />
Reymond auf ein bloßes "ignoramus" nötigen, da nicht klar<br />
ist, aus welcher Theorie der Zukunftsanspruch des<br />
"ignorabimus" logisch-deduktiv ableitbar wäre. Dem<br />
würden vermutlich Popper und Eccles in Bezug auf den<br />
genauen Interdependenzzusammenhang zwischen den<br />
drei Welten zustimmen können.<br />
Der Neurodeterminismus unserer Tage ist damit<br />
offenkundig nicht zufrieden. Er räumt zwar ein derzeitiges<br />
"ignoramus" ein, fügt jedoch ein verheißungsvolles "noch"<br />
hinzu: wir wissen es "noch nicht". So proklamiert zum<br />
Beispiel ein bekanntes Manifest von elf führenden<br />
Neurobiologen (2004), dass man in nicht allzu ferner<br />
Zukunft "widerspruchsfrei Geist, Bewusstsein, Gefűhle,<br />
Willensakte und Handlungsfreiheit als natűrliche Vorgänge<br />
ansehen wird, denn sie beruhen auf biologischen<br />
Prozessen“.<br />
Programmatischer Determinismus vs.<br />
hypothetische Interdependenz zwischen<br />
den drei Popper-Welten<br />
Die ganze Diskussion um Determinismus und<br />
Willensfreiheit wäre wesentlich entspannter, wenn die<br />
Kombattanden sich etwas strikter das Prinzip der<br />
Inkommensurabilität vor Augen hielten und sich von dort<br />
aus den erkenntnistheoretischen Status ihrer jeweils<br />
vertretenen Positionen klar machten. Niemand hätte etwas<br />
gegen einen Neurodeterminismus einzuwenden, der sich<br />
selbst als Forschungsprogramm deklarierte, welches unter<br />
dem leitenden Erkenntnisinteresse steht, die