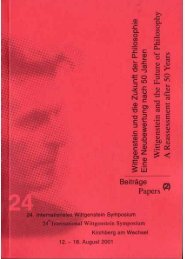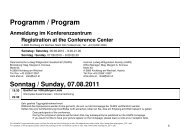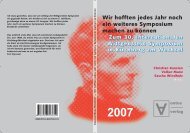Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Interkulturelle Philosophie in Russland: Tradition und<br />
Neuorientierungen<br />
Maja Soboleva, Philipps-University Marburg, Germany<br />
Das Phänomen „Interkulturelle Philosophie“ hat in<br />
Russland eine lange Geschichte, die zwei Perioden<br />
umfasst. Vom 19. bis Ende des 20. Jahrhunderts existierte<br />
interkulturelle Philosophie in Form einer Methode<br />
vergleichender Kulturforschung. In diesem Rahmen<br />
wurden zahlreiche Kulturtheorien und<br />
geschichtsphilosophische Konzeptionen entwickelt, die auf<br />
die Beschreibung verschiedener Kulturen und das<br />
Problem des Verhältnisses zwischen ihnen gezielt waren.<br />
Den Ausgangspunkt bildete dabei die sogenannte<br />
„russische Idee“ – ein besonderes Geschichtsverständnis,<br />
das Russland ins Zentrum aller kultur- und<br />
geschichtsphilosophischen Überlegungen stellte. Die<br />
Spezifik der russischen Volkskultur, die Rolle und Stellung<br />
Russlands in der Weltgeschichte, die Eigentümlichkeiten<br />
seiner Entwicklung waren herausragende Themen<br />
philosophischer Reflexion. Sie bereiteten das Fundament<br />
für die Beurteilung von historischen Ereignissen und den<br />
Aufbau des gesamten Weltbildes. Der Suche nach der<br />
kulturellen Selbstidentifikation Russlands verdanken ihre<br />
Entstehung beispielsweise die Geschichtskonzeptionen<br />
von Aleksej Chomjakov (1804 – 1860) und Fedor<br />
Dostoevskij (1821 – 1881), sowie die Theorie der<br />
kulturhistorischen Typen von Nikolaj Danilevskij (1822 –<br />
1885) und die soziale Ästhetik von Konstantin Leontjev<br />
(1831 – 1891).<br />
Der vergleichenden Kulturforschung, die die<br />
genannten Theorien präsentieren, liegen folgende<br />
Prinzipien zugrunde: Verständnis einer Kultur als<br />
Organismus, der in seiner Ontogenese unterschiedliche<br />
Entwicklungsstadien erlebt, Verständnis einer Kultur als<br />
ein erhaltendes psychisch-mentales Ganzes und<br />
Verständnis interkultureller Beziehungen nach<br />
Grundsätzen der Evolutionstheorie. Die russische<br />
kulturwissenschaftliche Tradition bietet somit eine<br />
naturalisierende Deutung der Kulturphänomene. Ein<br />
Beispiel dafür stellt die von Danilevskij ausgearbeitete<br />
Klassifizierung der «kulturhistorischen Typen» oder<br />
«eigenständigen Zivilisationen» aufgrund ihnen<br />
innewohnenden «morphologischen Prinzipien» dar. Die<br />
Kulturen unterscheiden sich durch psychische, sittliche<br />
Merkmale, ihre Begabungen und durch den «Gang und die<br />
Bedingungen ihrer historischen Erziehung» (Danilevskij<br />
1995).<br />
Die Reflexion auf die Besonderheiten der kulturellen<br />
Entwicklung Russlands im Vergleich mit anderen Ländern<br />
und vor allem mit Westeuropa geschah aufgrund einer<br />
dichotomischen Bewertungsskala. Man kann dabei<br />
Denkmuster finden, die für die Aufteilung der Kulturräume<br />
den Gegensatz „Wir“ und „Andere“ voraussetzen. Je nach<br />
dem persönlichen Standpunkt des Autors können folgende<br />
Denkschemata festgestellt werden: a) Bei dem<br />
eurozentrisch orientierten Čaadaev (1794 – 1856) kommt<br />
der Gedanke vor, dass Russland infolge seiner<br />
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rückständigkeit<br />
„Noch-nicht-Kultur“ ist. b) Chomjakov thematisiert<br />
Verhältnisse zwischen Russland und Westeuropa<br />
ausgehend von dem Paradigma „Kultur und Antikultur“,<br />
wobei Russland mit seinem „guten“ inneren Prinzip „Kultur“<br />
symbolisiert und Westen als „böse“ „Antikultur“ erscheint;<br />
c) Für die soziale Monadologie von Danilevskij ist die<br />
324<br />
Vorstellung von „Anderer Kultur“ grundlegend: In ihrer<br />
Eigenart wichen alle Kulturen prinzipiell voneinander ab,<br />
sind voneinander unabhängig und für einander<br />
unbegreifbar; d) Dostoevskij betrachtet russische Kultur als<br />
eine „Mit-Kultur“ der westeuropäischen: vom seinem<br />
zivilisatorischen Gesichtspunkt aus erscheint der<br />
Unterschied zwischen den beiden kulturellen Topoi als<br />
kein qualitativer, sondern als ein quantitativer.<br />
Die Grundideen der interkulturellen Forschungen<br />
innerhalb von zwei Jahrhunderten bestehen in der<br />
Behauptung der Unmöglichkeit einer<br />
allgemeinmenschlichen Kultur, in der Unzulässigkeit der<br />
Identifikation der Weltgeschichte mit der europäischen<br />
Geschichte, bei der das „Allgemeinmenschliche“ mit dem<br />
„Gesamteuropäischen“ gleichgesetzt wird, und in der<br />
Verneinung eines absoluten Fortschritts und des<br />
Vorhandenseins allgemein gültiger Maßstäbe bei dem<br />
Kulturvergleich. Die meisten Konzeptionen gehen von der<br />
Voraussetzung aus, dass das historische Ziel eines jeden<br />
Volkes in der Selbsterkenntnis besteht. Da die Kultur das<br />
Erkenntnismittel eines Volkes sei, sei jedes einzelne Volk<br />
dazu verpflichtet, seine eigene authentische Kultur zu<br />
entwickeln. Die Formel „Einheit in der Vielfalt“, die die<br />
Koexistenz verschiedener Kulturtypen behauptet, trifft man<br />
als regulative Idee bei vielen Forschern.<br />
Die kulturtheoretischen Annahmen, die im Rahmen<br />
einer naturalisierenden Geschichtsschreibung gemacht<br />
wurden, hatten handlungstheoretische Folgen. Die<br />
Beziehungen zwischen kulturellen Gebilden, von denen<br />
jedes ein abgeschlossenes Universum mit ihm<br />
innewohnenden Prinzipien darstellt, wurden als<br />
kontradiktorisch definiert: von ihrer Unvereinbarkeit wurde<br />
auf eine Konkurrenz zwischen ihnen geschlossen. Das<br />
Weltgeschehen erwies sich damit als ein unaufhörlicher<br />
Kampf verschiedener Kulturen gegeneinander. Begriffe<br />
wie „Entwicklung eigener Spezifik“, „Wettbewerb“ und<br />
„Konflikt“ markieren den Gedankengang russischer<br />
Kulturforschung. Integration in einen allgemein<br />
menschlichen Kulturraum war entweder ausgeschlossen,<br />
oder nur unter Bedingung der Aufrechterhaltung kultureller<br />
Eigenständigkeit jeder nationalen Kultur denkbar. Da<br />
gegenseitiges Mißtrauen als Norm zwischenkultureller<br />
Beziehungen betrachtet wurde, konnte ein interkultureller<br />
Dialog allein auf der Basis der „geschickten<br />
Anziehungskraft auf ehrerbietiger Distanz“ erfolgen<br />
(Leontjev 1966). Im Ganzen kann man behaupten, dass<br />
den meisten kulturtheoretischen Konzeptionen ein<br />
Abwehrnationalismus innewohnte. Als sein Resultat<br />
können die Theorien betrachtet werden, die dem<br />
kulturellen Imperialismus Westeuropas den<br />
großrussischen Messianismus entgegengesetzt haben,<br />
der die Vereinigung aller Menschen aufgrund der vom<br />
russischen Volk aufbewahrten orthodox-christlichen Werte<br />
ermöglichen soll.<br />
Die Entwicklung von Phänomenologie,<br />
Hermeneutik, Semiotik, Sprachphilosophie und<br />
dialogischer Philosophie im 20. Jahrhundert führten zum<br />
Paradigmenwechsel im Selbstverständnis der<br />
interkulturellen Philosophie. Dank der Phänomenologie<br />
wurden die Fragen nach der intersubjektiven