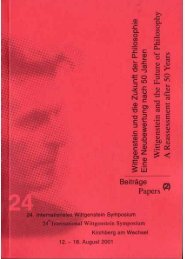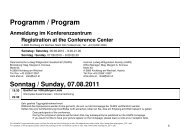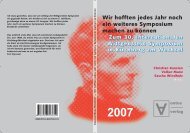Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Substanz, Kausalität und Freiheit<br />
Pedro Schmechtig, Technical University of Dresden, Germany<br />
I. Einführung<br />
Libertarianistische Konzeptionen der Handlungs- und<br />
Entscheidungsfreiheit werden gegenwärtig anhand von<br />
drei unterschiedlichen Ansätzen diskutiert: (a) Nichtkausale<br />
Theorien (Ginet 1990, McCann 1998) gehen<br />
davon aus, dass eine Handlung H nur dann frei ist, wenn<br />
es keine Entität gibt, durch die H verursacht wurde; (b)<br />
Indeterministisch-kausale Ansätze (Mele 1995, Ekstrom<br />
2000) betrachten eine Handlung H hingegen als frei, wenn<br />
H durch die mentalen Prozesse des Akteurs auf nichtdeterministische<br />
Weise verursacht wurde; (c) Und im<br />
Rahmen von klassischen Akteurskausalitäts-Theorien<br />
(Chisholm 1985, Taylor 1966) wird eine Handlung H<br />
solange für frei gehalten, wie sie durch ein substanzielles<br />
Einzelding – nämlich den Akteur selbst – verursacht ist.<br />
Unter ontologischen Gesichtspunkten stellen<br />
Ansätze, die unter (c) fallen eine besondere<br />
Herausforderung dar, da sie auf starken metaphysischen<br />
Annahmen beruhen, wie das Verhältnis von Kausalität und<br />
Freiheit im Handlungszusammenhang zu denken ist.<br />
Einerseits teilen sie mit den unter (a) angeführten nichtkausalen<br />
Theorien die Auffassung, dass freie Handlungen<br />
nicht auf eine der verschiedenen reduktionistischen<br />
Varianten der Ereigniskausalität zurückzuführen sind (z. B.<br />
Regularitätsthese, kontrafaktische Analyse oder<br />
probabilistischer Ansatz). Andererseits halten sie zwar<br />
daran fest, dass Handlungen das kausale Produkt der<br />
motivationalen Zustände einer Person sind, bezweifeln<br />
jedoch, dass sich allein auf dieser Grundlage erklären<br />
ließe, worin der libertarianistische Gedanke einer freien<br />
Entscheidung besteht.<br />
Als Gegenentwurf wird eine Art Substanzkausalität<br />
propagiert, die das Ziel hat, den interventionistischen<br />
Charakter menschlicher Handlungen in den Vordergrund<br />
zu rücken. Dieser Vorschlag beinhaltet jedoch zwei<br />
weitreichende Konsequenzen: Erstens wird davon<br />
ausgegangen, dass zwischen dem traditionellen<br />
Verständnis von Kausalität – beruhend auf einem<br />
deterministischen Begriff der Ereignisverursachung – und<br />
dem vorgeschlagenen Akteurskonzept eine nicht zu<br />
überwindende Kluft besteht, die daher rührt, dass Akteure,<br />
obgleich sie in der Lage sind bestimmte Ereignisse selbst<br />
zu initiieren, nicht der Verursachung eines<br />
vorausgehenden Ereignisses unterliegen. Damit hofft man<br />
dem allgemeinen Dilemma zu entgehen, dass freie<br />
Handlungen weder im Sinne einer vollständigen<br />
Verursachung extern determiniert sind, noch rein zufällig,<br />
auf der Basis glücklicher Umstände zustande kommen –<br />
denn in beiden Fällen wäre die Handlung der kausalen<br />
Kontrolle des Akteurs entzogen. Zweitens folgt, dass<br />
dasjenige Glied einer kausalen Relation, welches die<br />
Handlung oder einen mentalen Zustand verursacht, selbst<br />
kein Ereignis ist, sondern ein unabhängiges substanzielles<br />
Einzelding; und da solche Einzeldinge über die Zeit<br />
hinweg immer vollständig gegenwärtig sind, ist man<br />
zugleich auf die Behauptung verpflichtet, dass Akteure<br />
endurantistische Objekte im herkömmlichen Sinne sind<br />
(O’Connor 2002).<br />
Beide Konsequenzen und die Tatsache, dass<br />
letztlich nicht klar ist, was sich genau genommen hinter<br />
dem Begriff der Substanzkausalität verbirgt, haben Anlass<br />
302<br />
zu zahlreichen Einwänden gegeben (Aune 1977, Broad<br />
1952, Ginet 1990, van Inwagen 2002), die Vertreter des<br />
Akteurskonzepts in jüngster Zeit dazu bewogen haben,<br />
den ursprünglichen Ansatz einer nicht unbedeutsamen<br />
Revision zu unterziehen (Chisholm 1995, Clarke 1996,<br />
Markosian 1999, van Wachter 2003). Ausgangspunkt ist<br />
die These, dass es offenkundig ein Fehler war, darauf zu<br />
bestehen, dass sich Akteurs- und Ereigniskausalität<br />
unversöhnlich gegenüberstehen. Vielmehr muss es darum<br />
gehen, die traditionelle Sichtweise zu überwinden, wonach<br />
bei der Verursachung einer freien Handlung immer nur<br />
eine kausale Determinante im Spiel ist. Betrachtet man<br />
das Hervorbringen einer Handlung als ein komplexes kodeterminiertes<br />
Geschehen, das sich aus der simultanen<br />
Verschmelzung zweier nicht miteinander identischer<br />
Verursachungsketten zusammensetzt (‚double causation’)<br />
– wobei es einige Phasen des initiierten<br />
Handlungsereignisses gibt, die durch vorangegangene<br />
Ereignisse nicht-deterministisch verursacht wurden, und<br />
mindestens eine weitere Phase existiert, die der Akteur<br />
direkt, ohne eine vorhergehende Verursachung aufgrund<br />
seiner spontanen Entscheidung bewirkt hat – dann scheint<br />
der im Vorfeld behauptete Gegensatz hinfällig zu sein.<br />
Gemäß einer moderaten Lesart der Akteurskausalität sind<br />
beide Formen der Kausalität genau dann miteinander<br />
vereinbar, wenn man die Art der Ereignisverursachung –<br />
ähnlich der unter (b) angeführten Theorien – als<br />
indeterministisch betrachtet.<br />
Vertreter der moderaten Variante sind der Ansicht,<br />
dass die Annahme einer indeterministischen<br />
Ereignisverursachung nicht nur große Vorteile für die<br />
entsprechende Handlungserklärung bringt, sondern auch<br />
für eine höhere Plausibilität der Akteurskausalität sorgt.<br />
Aufgrund der Vereinbarkeit beider Konzepte soll es unter<br />
anderem möglich sein, den Standardeinwand zu<br />
entkräften, der besagt, dass Akteure, die als substanzielle<br />
Einzeldinge aufgefasst werden, nicht damit verträglich<br />
sind, dass Ursachen zeitlich datierbare Entitäten sind.<br />
Demgegenüber werde ich deutlich machen, dass auch ein<br />
moderater Ansatz der Akteurskausalität nicht in der Lage<br />
ist, für dieses Problem eine befriedigende Antwort zu<br />
liefern. Generell wird es sich als fraglich erweisen, ob der<br />
Rückgriff auf ein indeterministisches Verständnis der<br />
Ereigniskausalität wirklich geeignet ist, die<br />
inkompatibilistischen Intuitionen zu stützen, die mit einer<br />
libertarianistischen Auffassung der Handlungs- und<br />
Entscheidungsfreiheit für gewöhnlich verbunden sind.<br />
II. Das Problem der zeitlichen Verursachung<br />
Die Möglichkeit einer auf substanziellen Einzeldingen<br />
basierenden Akteurskausalität wurde bereits sehr früh<br />
durch einen Einwand von C. D. Broad (1952) attackiert:<br />
„ I see no prima facie objection to there being events<br />
that are not completely determined. But, in so far as an<br />
event is determined, an essential factor in its total<br />
causes must be other events. How can an event<br />
possibly be determined to happen at a certain date if its<br />
total cause contained no factor to which the notion of<br />
date has any application? And how can the notion of<br />
date have any application to anything that is not an<br />
event?” (Broad 1952, 215).