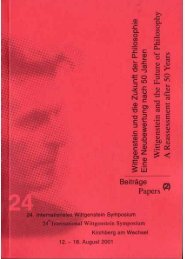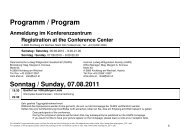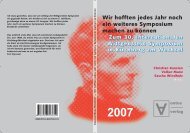Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Abweichung in seinem Sprachgebrauch produziert. Sie<br />
wollen nicht einsehen, dass es da eine Logik gibt, die zu<br />
dieser Häufung der Abweichungen zwingt. Die<br />
Kumulationseffekte der logischen Missverständnisse der<br />
Sprachstruktur sind eine Tatsache; natürlich wirken sie<br />
auch störend. Aber weil sie systematisch sind, wird deren<br />
Abbau dem Lerner ziemlich leicht vorkommen, wenn er<br />
einmal die Einsicht in seine nicht-korrekten Vermutungen<br />
bekommt. Noch besser ist es, wenn er einen Lehrer hat,<br />
der Erfahrungen über die Wurzeln und Routen der<br />
Missverständnisse hätte. Im Finnischen kommt es oft vor,<br />
dass der Lerner das Wort nicht identifiziert hat, weil der<br />
Stamm in einer Form anders aussieht als in einer anderen<br />
(z.B. sind wohl mäellä sowohl als auch mäkeä Formen des<br />
Wortes mäki ‚Hügel’). Ein deutschsprachiger Lerner kann<br />
das Objekt in einem Satz durch die deutsche Grammatik<br />
interpretieren und dabei doch die finnischen Regeln wohl<br />
systematisch folgen. Dieses wäre dadurch zu erklären,<br />
dass er die deutsche Begriffsbildung auf die von ihm<br />
produzierten Sätze bezieht.<br />
Aufgrund der angeführten Beispiele können wir nun<br />
folgende These festhalten: In einem interkulturellen Dialog<br />
soll man fähig sein, die eigene Sprache von einem<br />
allgemeinen Gesichtspunkt zu sehen. Und was interessant<br />
zu sehen ist: Dies lernen die Teilnehmenden allmählich.<br />
Durch das Kennen einiger allgemeiner Prinzipien könnte<br />
man das gegenseitige Verstehen beschleunigen. Dem<br />
Lerner sind unter anderem die folgenden Neigungen<br />
typisch: Bestrebung zur Systematik (wenn eine falsche<br />
Vorstellung zugrunde liegt, häufen sich die<br />
Missverständnisse; siehe oben), Vermeidung von<br />
Asymmetrie, Ignorieren der kognitiven Neuigkeiten und<br />
Bedürfnis, Agensstrukturen zu verstehen (s. Ellis 1994, 56,<br />
68, 326, 374–375.)<br />
Das Vokabular einer Sprache ist weit und<br />
vielschichtig; um das zu lernen, muss sich jeder viel Mühe<br />
geben. Es gibt aber jeweils bestimmte spracheigene<br />
logische oder unlogische [!] Strukturen, die die Non-nativespeakers<br />
ab und zu sogar genauer bemerken als die<br />
Muttersprachler.<br />
Der Lerner sucht die Symmetrie. Wenn es in der zu<br />
lernenden Sprache Asymmetrie gibt, wie es unvermeidlich<br />
doch manchmal der Fall ist, wird Lernen schwierig, sogar<br />
in denjenigen Fällen in denen es in der eigenen Sprache<br />
eine ähnliche Asymmetrie gibt. Z.B. hat man im Deutschen<br />
die Endung -er für jemanden, der etwas macht (fahren ><br />
der Fahrer). Wenn ein Verb vorkommt, in dem dieses sich<br />
nicht verwirklicht, wird es für einen Lerner schwierig. Man<br />
kann z.B. von dem häufig vorkommenden Verb sitzen ein<br />
Substantiv Sitzer bilden; es passt wohl in dem folgenden<br />
Zusammenhang SOFA 2-Sitzer DOMINA (www-Seiten<br />
eco-trade.de 17.4.<strong>2006</strong>), aber dieses bezieht sich nicht auf<br />
einen Menschen, der sitzt. Einige Wörter im Finnischen<br />
enthalten einen positiven Zug in sich, einige andere<br />
wiederum einen negativen. Man kann aber die meisten<br />
von den beiden Typen auch in einer umgekehrten<br />
Situation benutzen – freilich soll dabei ein Merkmal für<br />
diesen umgekehrten Gebrauch hinzugefügt werden.<br />
Wegen der Symmetrie wollen die Lerner ein Merkmal auch<br />
in gegensätzlichen Fällen gebrauchen. Das ist aber nicht<br />
nötig. Solche Sätze zu verstehen, kann problematisch<br />
werden, weil sie dem Lerner als irgendwie unvollendet<br />
vorkommen. Zum Beispiel sind Hän pärjää, Häneltä se<br />
sujuu ‚Er/sie wird es schon schaffen’ positiv, während; Hän<br />
pärjää huonosti, Häneltä se sujuu heikosti ‚Er/sie schafft<br />
es kaum’ negativ.<br />
318<br />
Sprache im interkulturellen Dialog - Kirsti Siitonen<br />
Kognitiv schwierig sich anzueignen sind solche<br />
Elemente oder Züge, die jemand sich wegen der fremden<br />
Denkweise nicht vorstellen kann. Wie ist es z.B. zu<br />
verstehen, wenn man mit einigen Verben Unabsichtlichkeit<br />
ausdrückt oder mit der Passivform immer ein<br />
menschliches Lebewesen verbindet, so wie im Finnischen.<br />
Ein Finne wiederum verbindet mit dem in der Passivform<br />
stehenden Verb im deutschen Satz im Autounfall wurden<br />
fünf Menschen getötet einen Täter. Die absurde<br />
Konsequenz ist, dass dieser es war, der nach dem Unfall<br />
angekommen ist und die betroffenen Personen z.B. mit<br />
einem Revolver umgebracht hat (vgl. wurden von<br />
jemandem getötet).<br />
In der Sprachphilosophie hat man im Laufe der<br />
Jahre häufig über die Beziehungen zwischen Sprache und<br />
Denken spekuliert und viele verschiedene<br />
Zusammenhänge finden wollen. Ich will in dieser Hinsicht<br />
vorsichtig sein. Die zahlreichen finnischen Satztypen, bei<br />
denen der Agens nicht explizit ausgedrückt wird und/oder<br />
das Subjekt fehlt, sind oft als Zeichen oder als Beweis der<br />
finnischen Zurückgezogenheit aufgefasst worden. In<br />
letzter Zeit wurde in der Linguistik aber behauptet, dass<br />
eben die subjektlosen Sätze den Sprechenden mehr nach<br />
vorne rücken als die anderen (Laitinen 1995). Wir werden<br />
hier diese Angelegenheit nicht entscheiden. Nur ist es für<br />
einen Finnischlerner wichtig zu wissen, dass die Struktur<br />
des Finnischen die Sätze ohne Subjekt zulässt und in<br />
einigen Fällen sogar fordert. Logischerweise werden dann<br />
die Finnen, die Deutsch sprechen, oft inkorrekt das<br />
Ausdrücken des Subjekts vermeiden. Sie verwenden z.B.<br />
statt des Satzes Ich fühle mich traurig den Satz Man fühlt<br />
sich traurig oder statt des Ausdruckes Ich meine… den<br />
Ausdruck Es wäre möglich zu denken, dass… Da würde<br />
ich vermuten, dass es in deutschen Ohren so klingt, als ob<br />
der Sprecher sehr scheu wäre, wenig Empathie fühle oder<br />
sich eben zurückziehe.<br />
Der interkulturelle Dialog wird schon auf einer<br />
Sprache geführt. Die bekannten, sog. groβen Sprachen<br />
haben ein bestimmtes Register für die offiziellen<br />
interkulturellen Begegnungen entwickelt. Die kleineren<br />
werden öfters inoffiziell benutzt und sind – so wie ich<br />
versuchte an einigen Fallbeispielen zu verdeutlichen – viel<br />
mehr den Fehleinschätzungen ausgesetzt.<br />
Literatur<br />
Buβmann, Hadumod (hrsg.) 2002 Lexikon der Sprachwissenschaft,<br />
3., akt. und erw. Auflage, Stuttgart: Afred Kröner Verlag.<br />
Ellis, Rod 2004 The Study of Second Language Acquisition,<br />
Oxford: Oxford University Press.<br />
Europarat 2001 Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für<br />
Sprachen: lernen, lehren, beurteilen, Berlin et al.<br />
Jackendoff, Ray 1990 Semantic Structures, Cambridge Mass.: The<br />
MIT Press.<br />
Laitinen, Lea 1995 „Nollapersoona“ (The zero person), Virittäjä 99,<br />
337–358.<br />
Latomaa, Sirkku 1996 „Matkalla uuteen kieleen” (Unterwegs zur<br />
neuen Sprache), in: Helena Ruuska and Sanna-Marja Tuomi (eds.)<br />
Moneja baareja. Tiellä toimivaan kaksikielisyyteen, Helsinki: ÄOL,<br />
97–105.<br />
McGuinness B. F. (hrsg.) 1984 <strong>Ludwig</strong> <strong>Wittgenstein</strong> und der<br />
Wiener Kreis. Gespräche, aufgezeichnet von Friedrich Waismann,<br />
Frankfurt am Main: Suhrkamp.<br />
Reichenbach, Hans 1947 Elements of Symbolic Logic, New York:<br />
The Macmillan Company.