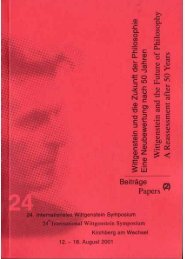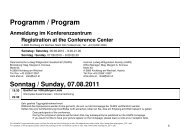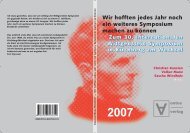Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Der Beitrag einer „Logik der Philosophie“ zum Verständnis des<br />
Dialogs der Kulturen<br />
Peter Oberhofer, University of Vienna, Austria<br />
Die Absicht der folgenden Ausführungen ist es, die von<br />
Eric Weil stammende Idee einer „Logik der Philosophie“<br />
(Weil 2 1996) systematisch aufzugreifen und für die Klärung<br />
von Möglichkeiten und Grenzen eines weltanschaulichen<br />
Dialogs zwischen den Kulturen fruchtbar zu machen. Im<br />
ersten Teil soll gezeigt werden, was unter einer „Logik der<br />
Philosophie“ zu verstehen ist und inwiefern sie rechtmäßig<br />
den Anspruch erheben kann, „Erste Philosophie“ zu sein.<br />
Im zweiten Teil wird ein kurzer Ausblick gegeben, wie eine<br />
Logik der Philosophie auf die kulturell verankerte<br />
Dialogsituation zwischen Weltanschauungen ein neues<br />
Licht zu werfen vermag.<br />
1. Eine „Logik der Philosophie“ als Erste<br />
Philosophie<br />
Der von einer Logik der Philosophie erhobene Anspruch,<br />
Erste Philosophie zu sein, soll uns als Ausgangspunkt<br />
dafür dienen, die Grundzüge einer Logik der Philosophie in<br />
einer Auseinandersetzung mit der Metaphysik/Ontologie<br />
(als der traditionellen Form von Erster Philosophie) auf<br />
systematische Weise zu entwickeln. Der genannte<br />
Anspruch geht aus einer zusammenfassenden Bemerkung<br />
Weils hervor: „Die Erste Philosophie ist also keine Theorie<br />
des Seins, sondern die Entwicklung des logos, des<br />
Diskurses, für sich selbst und durch sich selbst, in der<br />
Wirklichkeit der menschlichen Existenz, die sich in ihren<br />
Verwirklichungen versteht, insofern sie sich verstehen will.<br />
Sie ist nicht Ontologie, sie ist Logik, nicht des Seins,<br />
sondern des konkreten menschlichen Diskurses, der<br />
Diskurse, die den Diskurs in seiner Einheit bilden.“ (Weil<br />
2 1996, 69; übers. v. PO) Mit der hier angesprochenen<br />
Ersten Philosophie als einer Logik des konkreten<br />
menschlichen Diskurses ist die „Logik der Philosophie“<br />
selbst gemeint. Inwiefern ist es aber überhaupt nur<br />
denkbar, dass eine Logik des konkreten menschlichen<br />
Diskurses das Erbe der Metaphysik als Erster Philosophie<br />
antreten kann? Ist mit der metaphysischen Frage nach<br />
dem Seienden als Seienden, d.h. nach dem Sein des<br />
Seienden, nicht das Fundamentalniveau des<br />
philosophischen Fragens schon erreicht? Kann denn Erste<br />
Philosophie etwas anderes sein als die metaphysische<br />
„Grund- und Gesamtwissenschaft“ (Coreth 1994, 20)?<br />
Die Fundamentalität und Universalität der<br />
metaphysischen Frage liegt in der begrifflichen Eigenart<br />
von „Sein“ begründet. Ein gewöhnlicher, empirischer<br />
Begriff wird so gebildet, dass von den konkreten<br />
Differenzen, die zwischen den Dingen herrschen, die unter<br />
einen gemeinsamen Begriff gebracht werden sollen,<br />
abstrahiert wird, um derart eine Allgemeinheit aussagen zu<br />
können. Im Falle der empirischen Begriffsbildung gilt<br />
deshalb: Je allgemeiner ein Begriff, desto abstrakter, d.h.<br />
desto inhaltsleerer. Im Gegensatz dazu hat der Begriff des<br />
Seins diese außergewöhnliche Eigenschaft an sich, dass<br />
seine allumfassende Allgemeinheit keiner Abstraktion<br />
geschuldet sein kann: Mit dem Begriff „Sein“ wird nicht<br />
eine Einheit ausgesagt, die von allen Differenzen zwischen<br />
den Seienden abstrahierend absieht, denn auch die<br />
Differenzen zwischen den Seienden bzw. die individuelle<br />
Seinsweise sind etwas Seiendes und nicht nichts. Als<br />
allumfassende Einheit kann der Seinsbegriff nichts<br />
228<br />
abstrahierend ausschließen. Deshalb drückt der<br />
Seinsbegriff nicht eine abstrakte, sondern eine konkrete<br />
Allgemeinheit aus: Er meint nicht etwas Spezifisches am<br />
Seienden (etwa sein bloßes der-Fall-sein bzw. sein Dasssein<br />
im Unterschied zum Was-sein), sondern das jeweilige<br />
Seiende in seiner Gänze als solches. Die Einheit, die der<br />
Seinsbegriff bezeichnet, ist also eine Einheit, die nicht<br />
abstrahierend von den Differenzen absieht, sondern sie<br />
notwendig mit einschließt. Diese begriffliche Eigenart von<br />
„Sein“ wird traditionell als Analogie bezeichnet (vgl.<br />
Weissmahr 2 1991, 89ff.).<br />
Die der metaphysischen Tradition entnommene, hier<br />
nur kurz skizzierte Logik des Seinsbegriffs kann noch<br />
weiter entfaltet werden. Der Seinsbegriff ist<br />
transzendental, da er der empirischen Begriffsbildung als<br />
Ermöglichungsbedingung voraus liegt. Denn um aus der<br />
empirisch begegnenden Mannigfaltigkeit begriffliche<br />
Einheiten abstrahieren zu können, muss ich zuvor wissen,<br />
dass empirische Mannigfaltigkeit und begriffliche Einheit<br />
aufeinander bezogen werden können. Der Seinsbegriff<br />
bezeichnet nun genau dieses apriorische Wissen um die in<br />
sich differenzierte Totalität, innerhalb derer allererst<br />
begriffliche Bestimmungen des empirisch Gegebenen<br />
statthaben können. Mit „Sein“ verfüge ich über einen<br />
Begriff, der mich die in sich differenzierte, allumfassende<br />
Einheit benennen lässt, sodass ich innerhalb dieses<br />
ursprünglich analogen Feldes reine Einheiten (von den<br />
Differenzen abstrahierende Begriffe) bilden kann und,<br />
komplementär dazu, reine Differenzen, die sich der<br />
begrifflichen Einheitsbildung nicht fügen, behaupten kann.<br />
Jedoch können diese Einheiten und Differenzen niemals<br />
so rein sein, dass sie den analogen Grund, auf dem sie<br />
ruhen, jemals abschütteln können: Jede begriffliche<br />
Einheit ist bezogen auf eine Vielheit, innerhalb derer sie<br />
allererst die Einheit abstrahierend erblickt; und jede<br />
Differenzierung muss doch noch voraussetzen, dass das<br />
Differente wenigstens darin noch übereinkommt, ein<br />
Seiendes zu sein.<br />
Der angesprochene transzendentale Charakter des<br />
Seinsbegriffs ist jedoch nicht zu verstehen als<br />
Unabhängigkeit von aller empirischen Erfahrung. Die Rede<br />
von „Sein“ erhält ihre Legitimität ja dadurch, dass vom<br />
Seienden als Seienden gesprochen werden kann. Die<br />
Rede von Transzendentalität meint also nicht etwa, dass<br />
der Begriff des Seins das Seiende seinem Dasein nach<br />
hervorbringt, sondern präzise dies: Um ein empirisch<br />
Gegebenes als (so und so) Seiendes zu verstehen, bin ich<br />
auf ein nicht empirisch induziertes, d.h. ein<br />
transzendentales Verständnis von „Sein“ angewiesen.<br />
Dieses Verständnis ist so in Hinblick auf jedes empirische<br />
Verständnis ein Vorverständnis. In Hinblick darauf, dass<br />
„Sein“ immer das Sein eines empirisch begegnenden<br />
Seienden meint, wird nun die bloß formale Analogie-<br />
Struktur des Seinsbegriffs überschritten: Um zu einem<br />
Verständnis des Sein des Seienden zu werden, muss der<br />
Seinsbegriff im Sinne eines inhaltlichen Vorverständnisses<br />
entworfen werden. Der nicht nur formale Seinsbegriff trägt<br />
also einen Entwurfscharakter an sich, der sich nicht vom<br />
empirisch Gegebenen in seiner bloßen Gegebenheit<br />
ableiten lässt.