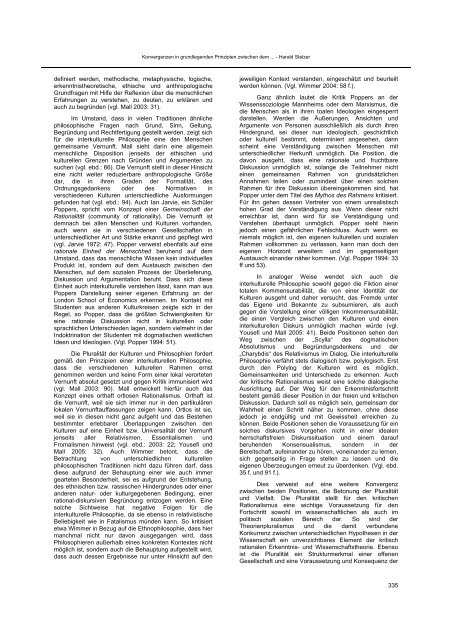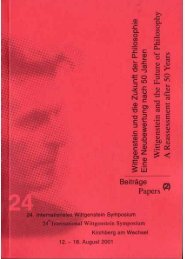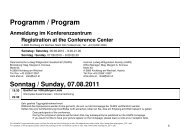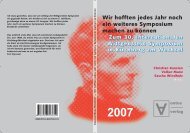Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
definiert werden, methodische, metaphysische, logische,<br />
erkenntnistheoretische, ethische und anthropologische<br />
Grundfragen mit Hilfe der Reflexion über die menschlichen<br />
Erfahrungen zu verstehen, zu deuten, zu erklären und<br />
auch zu begründen (vgl. Mall 2003: 31).<br />
Im Umstand, dass in vielen Traditionen ähnliche<br />
philosophische Fragen nach Grund, Sinn, Geltung,<br />
Begründung und Rechtfertigung gestellt werden, zeigt sich<br />
für die interkulturelle Philosophie eine den Menschen<br />
gemeinsame Vernunft. Mall sieht darin eine allgemein<br />
menschliche Disposition jenseits der ethischen und<br />
kulturellen Grenzen nach Gründen und Argumenten zu<br />
suchen (vgl. ebd.: 66). Die Vernunft stellt in dieser Hinsicht<br />
eine nicht weiter reduzierbare anthropologische Größe<br />
dar, die in ihren Graden der Formalität, des<br />
Ordnungsgedankens oder des Normativen in<br />
verschiedenen Kulturen unterschiedliche Ausformungen<br />
gefunden hat (vgl. ebd.: 94). Auch Ian Jarvie, ein Schüler<br />
Poppers, spricht vom Konzept einer Gemeinschaft der<br />
Rationalität (community of rationality). Die Vernunft ist<br />
demnach bei allen Menschen und Kulturen vorhanden,<br />
auch wenn sie in verschiedenen Gesellschaften in<br />
unterschiedlicher Art und Stärke erkannt und gepflegt wird<br />
(vgl. Jarvie 1972: 47). Popper verweist ebenfalls auf eine<br />
rationale Einheit der Menschheit beruhend auf dem<br />
Umstand, dass das menschliche Wissen kein individuelles<br />
Produkt ist, sondern auf dem Austausch zwischen den<br />
Menschen, auf dem sozialen Prozess der Überlieferung,<br />
Diskussion und Argumentation beruht. Dass sich diese<br />
Einheit auch interkulturelle verstehen lässt, kann man aus<br />
Poppers Darstellung seiner eigenen Erfahrung an der<br />
London School of Economics erkennen. Im Kontakt mit<br />
Studenten aus anderen Kulturkreisen zeigte sich in der<br />
Regel, so Popper, dass die größten Schwierigkeiten für<br />
eine rationale Diskussion nicht in kulturellen oder<br />
sprachlichen Unterschieden lagen, sondern vielmehr in der<br />
Indoktrination der Studenten mit dogmatischen westlichen<br />
Ideen und Ideologien. (Vgl. Popper 1994: 51).<br />
Die Pluralität der Kulturen und Philosophien fordert<br />
gemäß den Prinzipien einer interkulturellen Philosophie,<br />
dass die verschiedenen kulturellen Rahmen ernst<br />
genommen werden und keine Form einer lokal verorteten<br />
Vernunft absolut gesetzt und gegen Kritik immunisiert wird<br />
(vgl. Mall 2003: 90). Mall entwickelt hierfür auch das<br />
Konzept eines orthaft ortlosen Rationalismus. Orthaft ist<br />
die Vernunft, weil sie sich immer nur in den partikulären<br />
lokalen Vernunftauffassungen zeigen kann. Ortlos ist sie,<br />
weil sie in diesen nicht ganz aufgeht und das Bestehen<br />
bestimmter erlebbarer Überlappungen zwischen den<br />
Kulturen auf eine Einheit bzw. Universalität der Vernunft<br />
jenseits aller Relativismen, Essentialismen und<br />
Fromalismen hinweist (vgl. ebd.: 2003: 22; Yousefi und<br />
Mall 2005: 32). Auch Wimmer betont, dass die<br />
Betrachtung von unterschiedlichen kulturellen<br />
philosophischen Traditionen nicht dazu führen darf, dass<br />
diese aufgrund der Behauptung einer wie auch immer<br />
gearteten Besonderheit, sei es aufgrund der Entstehung,<br />
des ethnischen bzw. rassischen Hindergrundes oder einer<br />
anderen natur- oder kulturgegebenen Bedingung, einer<br />
rational-diskursiven Begründung entzogen werden. Eine<br />
solche Sichtweise hat negative Folgen für die<br />
interkulturelle Philosophie, da sie ebenso in relativistische<br />
Beliebigkeit wie in Fatalismus münden kann. So kritisiert<br />
etwa Wimmer in Bezug auf die Ethnophilosophie, dass hier<br />
manchmal nicht nur davon ausgegangen wird, dass<br />
Philosophieren außerhalb eines konkreten Kontextes nicht<br />
möglich ist, sondern auch die Behauptung aufgestellt wird,<br />
dass auch dessen Ergebnisse nur unter Hinsicht auf den<br />
Konvergenzen in grundlegenden Prinzipien zwischen dem ... - Harald Stelzer<br />
jeweiligen Kontext verstanden, eingeschätzt und beurteilt<br />
werden können. (Vgl. Wimmer 2004: 58 f.).<br />
Ganz ähnlich lautet die Kritik Poppers an der<br />
Wissenssoziologie Mannheims oder dem Marxismus, die<br />
die Menschen als in ihren toalen Ideologien eingesperrt<br />
darstellen. Werden die Äußerungen, Ansichten und<br />
Argumente von Personen ausschließlich als durch ihren<br />
Hindergrund, sei dieser nun ideologisch, geschichtlich<br />
oder kulturell bestimmt, determiniert angesehen, dann<br />
scheint eine Verständigung zwischen Menschen mit<br />
unterschiedlicher Herkunft unmöglich. Die Position, die<br />
davon ausgeht, dass eine rationale und fruchtbare<br />
Diskussion unmöglich ist, solange die Teilnehmer nicht<br />
einen gemeinsamen Rahmen von grundsätzlichen<br />
Annahmen teilen oder zumindest über einen solchen<br />
Rahmen für ihre Diskussion übereingekommen sind, hat<br />
Popper unter dem Titel des Mythos des Rahmens kritisiert.<br />
Für ihn gehen dessen Vertreter von einem unrealistisch<br />
hohen Grad der Verständigung aus. Wenn dieser nicht<br />
erreichbar ist, dann wird für sie Verständigung und<br />
Verstehen überhaupt unmöglich. Popper sieht hierin<br />
jedoch einen gefährlichen Fehlschluss. Auch wenn es<br />
niemals möglich ist, den eigenen kulturellen und sozialen<br />
Rahmen vollkommen zu verlassen, kann man doch den<br />
eigenen Horizont erweitern und im gegenseitigen<br />
Austausch einander näher kommen. (Vgl. Popper 1994: 33<br />
ff und 53).<br />
In analoger Weise wendet sich auch die<br />
interkulturelle Philosophie sowohl gegen die Fiktion einer<br />
totalen Kommensurabilität, die von einer Identität der<br />
Kulturen ausgeht und daher versucht, das Fremde unter<br />
das Eigene und Bekannte zu subsumieren, als auch<br />
gegen die Vorstellung einer völligen Inkommensurabilität,<br />
die einen Vergleich zwischen den Kulturen und einen<br />
interkulturellen Diskurs unmöglich machen würde (vgl.<br />
Yousefi und Mall 2005: 41). Beide Positionen sehen den<br />
Weg zwischen der „Scylla“ des dogmatischen<br />
Absolutismus und Begründungsdenkens und der<br />
„Charybdis“ des Relativismus im Dialog. Die interkulturelle<br />
Philosophie verfährt stets dialogisch bzw. polylogisch. Erst<br />
durch den Polylog der Kulturen wird es möglich,<br />
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen. Auch<br />
der kritische Rationalismus weist eine solche dialogische<br />
Ausrichtung auf. Der Weg für den Erkenntnisfortschritt<br />
besteht gemäß dieser Position in der freien und kritischen<br />
Diskussion. Dadurch soll es möglich sein, gemeinsam der<br />
Wahrheit einen Schritt näher zu kommen, ohne diese<br />
jedoch je endgültig und mit Gewissheit erreichen zu<br />
können. Beide Positionen sehen die Voraussetzung für ein<br />
solches diskursives Vorgehen nicht in einer idealen<br />
herrschaftsfreien Diskurssituation und einem darauf<br />
beruhenden Konsensualismus, sondern in der<br />
Bereitschaft, aufeinander zu hören, voneinander zu lernen,<br />
sich gegenseitig in Frage stellen zu lassen und die<br />
eigenen Überzeugungen erneut zu überdenken. (Vgl. ebd.<br />
35 f. und 91 f.).<br />
Dies verweist auf eine weitere Konvergenz<br />
zwischen beiden Positionen, die Betonung der Pluralität<br />
und Vielfalt. Die Pluralität stellt für den kritischen<br />
Rationalismus eine wichtige Voraussetzung für den<br />
Fortschritt sowohl im wissenschaftlichen als auch im<br />
politisch sozialen Bereich dar. So sind der<br />
Theorienpluralismus und die damit verbundene<br />
Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Hypothesen in der<br />
Wissenschaft ein unverzichtbares Element der kritisch<br />
rationalen Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie. Ebenso<br />
ist die Pluralität ein Strukturmerkmal einer offenen<br />
Gesellschaft und eine Voraussetzung und Konsequenz der<br />
335