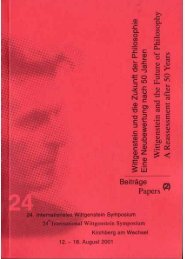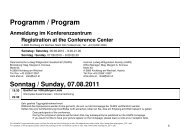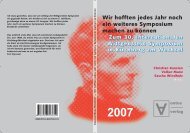Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kulturelle Gegenstände und intentionale Erlebnisse<br />
Alessandro Salice, Graz, Austria and Torino, Italy<br />
1. Einleitung<br />
Selbst im vorphilosophischen Kontext begegnen wir täglich<br />
der Rede von „kulturellen Unterschieden“, von „kulturellen<br />
Merkmalen“ usw. Das Adjektiv „kulturell“ scheint ein<br />
Indexical zu sein. Damit beziehe ich mich auf den<br />
Anschein, dass Sätze, welche diesen Ausdruck enthalten,<br />
Gültigkeit nur innerhalb eines bestimmten – eben<br />
kulturellen – Kontextes beanspruchen können. Wenn man<br />
behauptet,<br />
(1) Die Symmetrie ist ein altgriechisches kulturelles<br />
Schönheitskriterium<br />
äußert man die Meinung, dass Symmetrie innerhalb<br />
des altgriechischen Kulturkreises bloß bzw. ein<br />
Schönheitskriterium spezifisch für diese Kultur ist. Was<br />
bezeichnet nun das Substantiv „Kultur“? Hat man es hier<br />
mit besonderen Gegenständlichkeiten zu tun? Was für<br />
eine Eigenschaft ist „Kulturbedingtheit“?<br />
Beginnen wir mit einer mir nötig erscheinenden<br />
Voranmerkung: „Kulturbedingtheit“ kann mindestens zwei<br />
verschiedene Bedingtheitsformen involvieren. Die erste<br />
Form sieht Kulturbedingtheit in Seinsgegenständlichkeiten,<br />
die zweite in Sollensgegenständlichkeiten gegeben.<br />
Demgemäß sind ein bestimmtes Sein oder ein besonderes<br />
Sollen bloß innerhalb einer bestimmten Kultur vorzufinden.<br />
Als Aufgabe stelle ich mich den „Seinsaspekt“ der<br />
kulturellen Welt zu erforschen. Es geht mir hier darum,<br />
wesentliche Merkmale von Kulturen, die Seinsmerkmale<br />
darstellen, zu beschreiben. Sprachphilosophisch bedeutet<br />
dies, dass ich nur derartige Aussagesätze über Kulturen<br />
zu erklären versuche, welche ausschließlich<br />
Seinsprädikate enthalten (ein Gegenstand X ist oder ist<br />
nicht durch eine Kultur Y bedingt). Um den Gegenstand<br />
der Untersuchung weiter zu präzisieren, klammere ich<br />
innerhalb der Seinsprädikationen alle werttheoretischen<br />
Aussagen wie z.B.<br />
(2) Die Monogamie ist ein kultureller Wert<br />
von der Erörterung aus.<br />
2. Die Erlebnisstruktur<br />
Die Frage nach der Kulturbedingtheit von Gegenständen<br />
setzt eine Erörterung der Intentionalität voraus. Obgleich<br />
auf einen ersten Blick diese Thematik keine Verbindung zu<br />
dem hier zu untersuchenden Problemhorizont aufzuweisen<br />
scheint, bin ich davon überzeugt, dass die oben gestellte<br />
Frage nur beantwortet werden kann, wenn vorgängig die<br />
intentionale Struktur von Akten geklärt ist.<br />
Wesensmerkmal intentionaler Akte ist die<br />
Gerichtetheit auf etwas: Ein Akt ist intentional, weil er stets<br />
auf etwas zielt. Ein introspektiver Blick auf sich selbst<br />
fördert eine Fülle verschiedener intentionaler Erlebnisse zu<br />
Tage: Ich stelle mir etwas vor, ich verspreche jemandem<br />
etwas... Die intentionalen Korrelate dieser Akte können in<br />
ihrer Verschiedenheit unter zwei Hauptkategorien rubriziert<br />
werden: Korrelate sind entweder Sachverhalte oder<br />
Gegenstände. (So sieht jedenfalls meine Bezugsontologie<br />
aus.) Wie nun strukturiert sich der intentionale Bezug?<br />
Eine der großen Leistungen der realistischen<br />
Phänomenologie besteht darin, eine präzise Beschreibung<br />
von Intentionalität geliefert zu haben, welche um den<br />
Begriff des psychischen Inhaltes bzw. der intentionalen<br />
Materie kreist. Diesen Begriff verwende ich in engem<br />
Anschluss an die Überlegungen Adolf Reinachs, benutze<br />
ihn jedoch rein systematisch und erhebe vor allem keinen<br />
Anspruch auf eine philosophie-historisch getreue<br />
Darstellung.<br />
Die Funktion des Inhaltes ist zwiespältig: Einerseits<br />
konstant bei jedem Akttyp vorhanden unterscheidet sie<br />
sich andrerseits je nach dem, zu welchem Akttyp der Inhalt<br />
gehört. Die konstante Rolle des Inhalts ist eine strukturelle<br />
und formale, denn sie wird von der Erlebnisstruktur<br />
verlangt. Sie sieht von einer näheren Charakterisierung<br />
des Aktes oder des gegenständlichen Aktkorrelates ab.<br />
Jeder intentionale Akt bezieht sich genau auf ein<br />
gegenständliches Korrelat. Für die Korrelate selbst<br />
eröffnet sich eine unendliche Vielfalt und Variation: Ein<br />
Korrelat kann bestehen oder nicht, es kann existieren<br />
(ideell oder real) oder nicht. Es ist immer dem Akt<br />
transzendent und ist kein konkreter Teil des Aktes. Die<br />
Rose, die man sich vorstellt, oder die Zahl, die man denkt,<br />
haben ganz eigentlich keinen Platz in einem Bewusstsein.<br />
Es muss aber etwas im Bewusstsein geben, das diesen<br />
Gegenständen entspricht, denn der Akt, der eine<br />
Gegenständlichkeit erfasst, unterscheidet sich von einem<br />
Akt desselben Typs, der eine andere Gegenständlichkeit<br />
erfasst. Da beide Akte dem Bewusstsein immanent sind,<br />
ist die Frage berechtigt, was beide Akte unterscheidet. Die<br />
zwei Gegenständlichkeiten selbst können die Akte nicht<br />
unterscheiden, denn beide sind sie als<br />
Gegenständlichkeiten dem Akt transzendent. Es muss also<br />
etwas geben, das im Akt liegt, Zugang zu den<br />
Gegenständlichkeiten verschafft und das den ersten von<br />
einem zweiten Akt absondert. Dieses Element nennen wir<br />
den „Inhalt“ eines Aktes. Mit „Inhalt“ ist nur ein<br />
struktureller, konkreter Erlebnisteil gemeint, der es dem<br />
Akt ermöglicht, genau diese Gegenständlichkeit intentional<br />
zu treffen.<br />
Formale und strukturelle Inhaltsfunktion<br />
vorausgesetzt skizziere ich nun die variable Rolle des<br />
Inhaltes an Hand dreier Akttypen: Vorstellen, Denken und<br />
Handeln. Dem Inhalt einer Vorstellung entspricht eine<br />
repräsentierende Rolle. Damit meine ich Folgendes: Ein<br />
Vorstellungsakt ist passiv und dient der Rezeption eines<br />
Gegenstandes. Obwohl sich der Gegenstand nie in ganzer<br />
Vollständigkeit präsentiert, weil er immer unter diesem<br />
oder jenem Aspekt abgeschattet ist, stellt man sich den<br />
gesamten Gegenstand vor. Das wird dadurch ermöglicht,<br />
dass der Vorstellungsinhalt eine gewisse<br />
Anschauungsfülle besitzt, welche den ganzen Gegenstand<br />
repräsentiert. Der Gegenstand ist intuitiv zwar nicht<br />
vollständig präsent, aber die Anschauungsfülle, welche der<br />
Vorstellungsinhalt mit einem bestimmten Grade<br />
notwendigerweise in sich trägt, repräsentiert auch die<br />
abgeschatteten Seiten des Gegenstandes. Vorsicht ist<br />
allerdings geboten, denn es ist darauf hinzuweisen, dass<br />
das, was ich hier als „Vorstellung“ beschrieben habe,<br />
keine begriffliche Vorstellung ist. „Begriffliche<br />
Vorstellungen“ (welche genau genommen gar keine<br />
Vorstellungen, sondern ein Sachverhaltserkennen sind)<br />
besitzt man immer dann, wenn man etwas als etwas<br />
erfasst. Ein derartiges Erfassen involviert immer einen<br />
Begriff und ist von komplexerer Natur.<br />
289