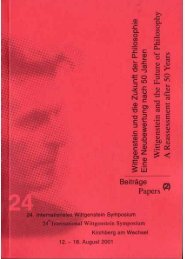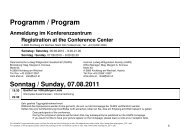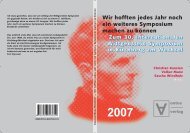Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Preproceedings 2006 - Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Spiel der Sprache und Sprachspiel – Gadamer und <strong>Wittgenstein</strong> im Vergleich - Juliane Reichel<br />
erfüllt sind; genauso wie bei einem gelungenen Spiel.<br />
(Gadamer 1986a: 152) An anderer Stelle spricht Gadamer<br />
von der “verwandelnden Kraft” des Gespräches. Wer<br />
intensiv über eine Sache gesprochen hat, kommt zu neuen<br />
Einsichten, dem werden Probleme bewußt, die er vorher<br />
gar nicht gesehen hat und die ihn zu neuem Nachdenken<br />
anregen, kurz: “Wo ei! n Gespräch gelungen ist, ist uns<br />
etwas geblieben und ist in uns etwas geblieben, das uns<br />
verändert hat.” (Gadamer 1986a: 211) In dieser<br />
Gesprächserfahrung spiegelt sich auch der Prozeß des<br />
Verstehens wider. Nur durch das Miteinandersprechen<br />
können wir uns verständigen und das heißt über eine<br />
Sache verständigen. “Im Miteinandersprechen treten wir<br />
vielmehr ständig in die Vorstellungswelt des anderen über,<br />
lassen uns gleichsam auf ihn ein und er sich auf uns […]<br />
bis das Spiel des Gebens und Nehmens, das eigentliche<br />
Gespräch, beginnt.” (Gadamer 1986a: 131) Das<br />
Miteinandersprechen, das Einander Verstehenwollen<br />
durch das Austauschen von Weltbildern kommt durch uns<br />
Menschen niemals zu einem Ende. Frage und Antwort<br />
eines Gespräches bilden einen unendlichen und letztlich<br />
offenen Dialog. (Gadamer 1986a: 210, 153)<br />
2. <strong>Wittgenstein</strong>s Sprachspielkonzept<br />
Anders als Gadamer gibt <strong>Wittgenstein</strong> keine Definition von<br />
dem Begriff des “Spieles”. Nach <strong>Wittgenstein</strong> ist dies sogar<br />
unmöglich, weil es sich beim Spiel um einen Ausdruck<br />
handelt, der sich nicht durch Angabe eines spezifischen<br />
Merkmales erfassen läßt. Vielmehr hängt die Bedeutung<br />
von den vielen verschiedenen Kontexten ab, in denen er<br />
Verwendung findet. <strong>Wittgenstein</strong> hat diese Art Begriffe<br />
bekanntlich Familienähnlichkeitsbegriffe genannt.<br />
(<strong>Wittgenstein</strong>: PU §§66ff) Wie die Mitglieder einer Familie<br />
miteinander verwandt sind, so verhält es sich auch mit den<br />
Familienähnlichkeitsbegriffen. Es ist gewiß kein Zufall, daß<br />
<strong>Wittgenstein</strong> zur Illustration dieser<br />
Familienähnlichkeitsbegriffe den Ausdruck “Spiel” gewählt<br />
hat. Es dürfte kaum ein anderes Wort geben, das sich<br />
durch eine derartige Verwendungsvielfalt auszeichnet,<br />
allein, was es alles für Spiele gibt und was alles als Spiel<br />
verstanden werden kann, ist unüberschaubar. Du! rch<br />
diese dem Spielbegriff innewohnende Vielschichtigkeit<br />
zeichnet sich das Spiel entsprechend als Modell aus, das<br />
<strong>Wittgenstein</strong> dem, was Sprache ist, zugrundelegt und das<br />
als “Sprachspiel” in die Philosophiegeschichte<br />
eingegangen ist.<br />
<strong>Wittgenstein</strong>s Intention in den PU ist es, der<br />
Sprache ein angemessenes Bild zu geben. (<strong>Wittgenstein</strong>:<br />
PU §130) Demnach läßt sich Sprache am besten von dem<br />
Modell des Spieles erfassen: Sprache zeichnet sich vor<br />
allem als Tätigkeit aus, einem Handeln, das bestimmten<br />
Regeln folgt, genau wie sich Spiele auch durch<br />
Handlungen und Regeln auszeichnen. Das Regelfolgen,<br />
das <strong>Wittgenstein</strong> für die Sprache-Spiel-Analogie für<br />
wesentlich hält, findet sich im Gadamerschen Konzept in<br />
dem Aspekt eines allgemeinen Ordnungsgefüges wieder,<br />
das Spiele grundsätzlich auszeichnet und für Menschen<br />
durch Regeln und selbstgesetzte Spielaufgaben entsteht.<br />
(Gadamer<br />
5 1986: 112, 113) <strong>Wittgenstein</strong>s zentraler<br />
Gedanke fußt darauf, daß sich der Sprachgebrauch von<br />
nichtsprachlichen Handlungen nicht trennen läßt. Für die<br />
Sprache ist das Eingeordnetsein in Handlungskontexte<br />
konstitutiv. Was Worte bedeuten, ergibt sich vor allem aus<br />
ihrer Verwendungsweise, daraus, welchen Worten welche<br />
Taten folgen: “Unsere Rede erhält durch unsre übrigen<br />
Handlungen ihren Sinn.” (<strong>Wittgenstein</strong>: ÜG §229) und “…<br />
Eine Bedeutung eines Wortes ist eine Art seiner<br />
Verwendung. Denn sie ist das, was wir erlernen, wenn das<br />
Wort zuerst unserer Sprache einverleibt wird.”<br />
(<strong>Wittgenstein</strong>: ÜG §61) Diese Verwendung von Worten ist<br />
keineswegs von den einzelnen Menschen willkürlich<br />
einsetzbar, sondern unterliegt einem gewissen<br />
Regelkanon, den wir durch Abrichtung erlernen und der<br />
durch Gebräuche, Institutionen beziehungsweise<br />
Gepflogenheiten gewährleistet wird. (<strong>Wittgenstein</strong>: PU<br />
§199) Gleichwohl dieser Regelk! anon kein festgefügtes<br />
unerschütterliches Gebäude ist, das ein für alle Mal gilt.<br />
Regeln können sich ändern, und sie werden manchmal im<br />
Gebrauch neu aufgestellt. <strong>Wittgenstein</strong> denkt wieder an<br />
sein Modell des Spieles:<br />
“Steckt uns da nicht die Analogie der Sprache mit dem<br />
Spiel ein Licht auf? Wir können uns doch sehr wohl<br />
denken, daß sich Menschen auf einer Wiese damit<br />
unterhielten, mit einem Ball zu spielen, so zwar, daß sie<br />
verschiedene bestehende Spiele anfingen, manche zu<br />
Ende spielten, dazwischen den Ball planlos in die Höhe<br />
würfen […] Und nun Einer: Die ganze Zeit hindurch<br />
spielen die Leute ein Ballspiel, und richten sich daher<br />
bei jedem Wurf nach bestimmten Regeln. Und gibt es<br />
nicht auch den Fall, wo wir spielen und – ,make up the<br />
rules as we go along?` Ja, auch den, in welchem wir sie<br />
abändern – as we go along.” (<strong>Wittgenstein</strong>: PU §83)<br />
Der Aspekt der Tradition erweist sich für<br />
<strong>Wittgenstein</strong> als genauso wichtig wie für Gadamer und<br />
spiegelt sich in <strong>Wittgenstein</strong>s Ausdruck der<br />
“Naturgeschichte” wider. Damit sind laut Arnswald die<br />
gemeinsamen Gewohnheiten, Traditionen, Regeln und<br />
sozialen Institutionen von Menschen gemeint, die dafür<br />
sorgen, daß wir in unserem Handeln übereinstimmen und<br />
uns die Sicherheit liefern, daß wir so und nicht anders<br />
handeln. (Arnswald 2002: 34) “[…] Befehlen, fragen,<br />
erzählen, plauschen gehören zu unserer Naturgeschichte<br />
so, wie gehen, essen, trinken, spielen.” (<strong>Wittgenstein</strong>: PU<br />
§25) und “Du mußt bedenken, daß das Sprachspiel<br />
sozusagen etwas Unvorhersehbares ist. Ich meine: Es ist<br />
nicht begründet. Nicht vernünftig (oder unvernünftig). Es<br />
steht da – wie unser Leben.” (<strong>Wittgenstein</strong>: ÜG §559)<br />
3. Gadamer und <strong>Wittgenstein</strong><br />
Aufgrund seines hohen Lebensalters hat Gadamer<br />
gegenüber <strong>Wittgenstein</strong> den elementaren Vorteil, daß er<br />
<strong>Wittgenstein</strong>s Lebenswerk eingehend zur Kenntnis hat<br />
nehmen können, was umgekehrt sicherlich nicht der Fall<br />
ist. Für einen Vergleich der Sprache-Spiel-Konzeption der<br />
beiden Denker mag es zunächst interessant sein, zu<br />
sehen, was für ein Verhältnis Gadamer zum<br />
<strong>Wittgenstein</strong>schen Denken einnimmt. Abgesehen von<br />
einigen verstreuten Bemerkungen in seinem Gesamtwerk<br />
hat sich Gadamer in Die phänomenologische Bewegung<br />
eingehender mit <strong>Wittgenstein</strong> befaßt. Neben Gadamers<br />
Kritik am Traktat und dessen logischem Reduktionismus<br />
der Sprache interessiert Gadamer vor allem <strong>Wittgenstein</strong>s<br />
spätere Selbstkritik an seiner frühen Auffassung der<br />
Sprache. Gadamer betont <strong>Wittgenstein</strong>s Hinwendung zum<br />
lebendigen Gebrauch der Sprache, der Warnungen vor<br />
falschen Übertragungen von einem Sprachspiel in ein<br />
anderes und einem metaphysischen Sprachgebrauch.<br />
(Gadamer 1987: 144) Daß Philosophie nur als sprachliche<br />
Selbstkritik im Sinne einer Selbstheilung fungieren soll,<br />
stößt auf Widerstand im Gadamerschen Denken: das ist<br />
dem am produktiven Dialog orientierten Gadamer zu<br />
negativ. Auch stellt er in Frage, ob nicht <strong>Wittgenstein</strong>s<br />
eigene Beschreibungen der Sprache anhand von<br />
“Gebrauch, Verwendung der Wörter” oder “Lebensform”<br />
nicht selbst der Sprachkritik unterzogen, also<br />
273