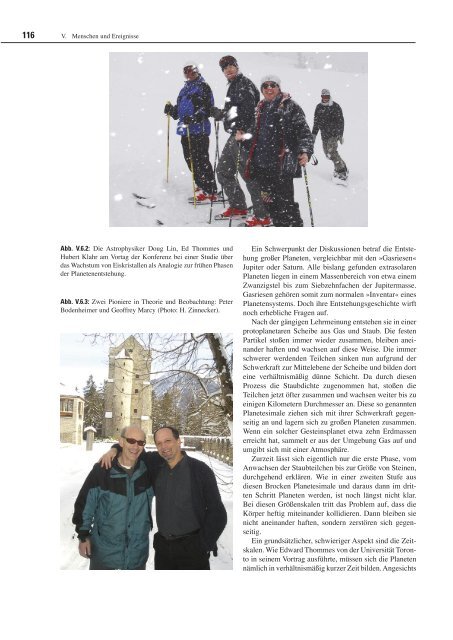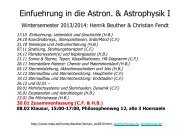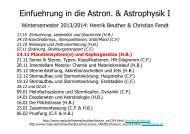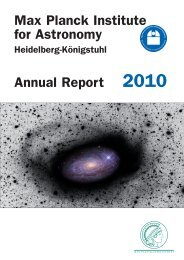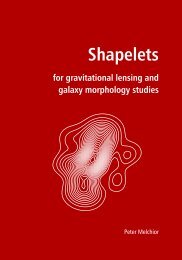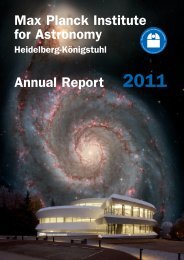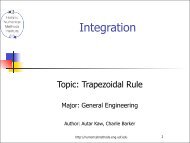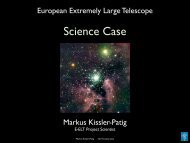V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
116 V. <strong>Menschen</strong> <strong>und</strong> <strong>Ereignisse</strong><br />
Abb. V.6.2: Die Astrophysiker Doug Lin, Ed Thommes <strong>und</strong><br />
Hubert Klahr am Vortag der Konferenz bei einer Studie über<br />
das Wachstum von Eiskristallen als Analogie zur frühen Phasen<br />
der Planetenentstehung.<br />
Abb. V.6.3: Zwei Pioniere in Theorie <strong>und</strong> Beobachtung: Peter<br />
Bodenheimer <strong>und</strong> Geoffrey Marcy (Photo: H. Zinnecker).<br />
Ein Schwerpunkt der Diskussionen betraf die Entstehung<br />
großer Planeten, vergleichbar mit den »Gasriesen«<br />
Jupiter oder Saturn. Alle bislang gef<strong>und</strong>en extrasolaren<br />
Planeten liegen in einem Massenbereich von etwa einem<br />
Zwanzigstel bis zum Siebzehnfachen der Jupitermasse.<br />
Gasriesen gehören somit zum normalen »Inventar« eines<br />
Planetensystems. Doch ihre Entstehungsgeschichte wirft<br />
noch erhebliche Fragen auf.<br />
Nach der gängigen Lehrmeinung entstehen sie in einer<br />
protoplanetaren Scheibe aus Gas <strong>und</strong> Staub. Die festen<br />
Partikel stoßen immer wieder zusammen, bleiben aneinander<br />
haften <strong>und</strong> wachsen auf diese Weise. Die immer<br />
schwerer werdenden Teilchen sinken nun aufgr<strong>und</strong> der<br />
Schwerkraft zur Mittelebene der Scheibe <strong>und</strong> bilden dort<br />
eine verhältnismäßig dünne Schicht. Da durch diesen<br />
Prozess die Staubdichte zugenommen hat, stoßen die<br />
Teilchen jetzt öfter zusammen <strong>und</strong> wachsen weiter bis zu<br />
einigen Kilometern Durchmesser an. Diese so genannten<br />
Planetesimale ziehen sich mit ihrer Schwerkraft gegenseitig<br />
an <strong>und</strong> lagern sich zu großen Planeten zusammen.<br />
Wenn ein solcher Gesteinsplanet etwa zehn Erdmassen<br />
erreicht hat, sammelt er aus der Umgebung Gas auf <strong>und</strong><br />
umgibt sich mit einer Atmosphäre.<br />
Zurzeit lässt sich eigentlich nur die erste Phase, vom<br />
Anwachsen der Staubteilchen bis zur Größe von Steinen,<br />
durchgehend erklären. Wie in einer zweiten Stufe aus<br />
diesen Brocken Planetesimale <strong>und</strong> daraus dann im dritten<br />
Schritt Planeten werden, ist noch längst nicht klar.<br />
Bei diesen Größenskalen tritt das Problem auf, dass die<br />
Körper heftig miteinander kollidieren. Dann bleiben sie<br />
nicht aneinander haften, sondern zerstören sich gegenseitig.<br />
Ein gr<strong>und</strong>sätzlicher, schwieriger Aspekt sind die Zeitskalen.<br />
Wie Edward Thommes von der Universität Toronto<br />
in seinem Vortrag ausführte, müssen sich die Planeten<br />
nämlich in verhältnismäßig kurzer Zeit bilden. Angesichts