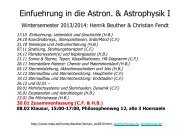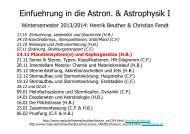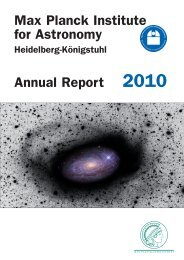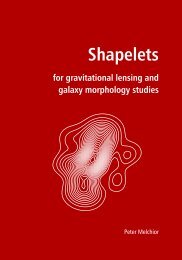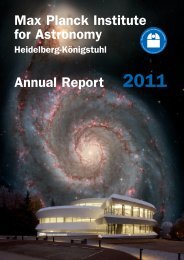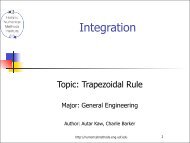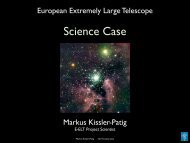V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
schichte der innersten 8 Bogensek<strong>und</strong>en (etwa 230 pc)<br />
kann durch zwei jüngere Ausbruchereignisse vor etwa 5<br />
<strong>und</strong> 15 Millionen Jahren beschrieben werden, bei denen<br />
jeweils r<strong>und</strong> (5 – 10) 10 7 Sonnenmassen an molekularem<br />
Gas in Sterne umgewandelt wurden. Die abgeleitete<br />
Extinktion von A V 10 mag in Richtung der Kernregion<br />
ist überraschend hoch angesichts der Tatsache, dass wir<br />
fast genau von oben auf das System blicken. Als eine<br />
der nächsten (D = 5.5 Mpc) Galaxien mit intensiver<br />
Sternentstehung im Kern bietet NGC 6946 eine einmalige<br />
Gelegenheit, die Dynamik ihrer zirkumnuklearen<br />
Scheibe aus molekularem Gas zu untersuchen. In dieser<br />
Entfernung erfasst die vom PdBI bei 1 mm Wellenlänge<br />
gelieferte Auflösung von 0.6 Bogensek<strong>und</strong>en räumliche<br />
Skalen von nur etwa 15 pc.<br />
Die Verteilung des molekularen Gases im Zentrum<br />
wurde durch unsere neuen PdBI-Beobachtungen in eine<br />
S-förmige Struktur aufgelöst (Abb. III.4.4). Die CO(1-0)<br />
-Linienemission erfasst die großräumigere Verteilung in<br />
der zentralen Bogenminute <strong>und</strong> zeigt, dass die Verteilung<br />
des molekularen Gases im Allgemeinen dem Muster<br />
jüngster Sternentstehung ähnelt. Dennoch liegen das<br />
molekulare Gas <strong>und</strong> die jungen HII-Regionen räumlich<br />
nicht beieinander. In den zentralen 300 pc erinnert die<br />
Verteilung des molekularen Gases sehr stark an die Gas/<br />
Staubbänder, die man entlang großräumiger Kiloparsec-<br />
Balken findet. Der im nahen Infrarot entdeckte stellare<br />
Balken im Kern könnte eine mögliche Erklärung hier<strong>für</strong><br />
sein. Eine vorläufige Auswertung der Kinematik des<br />
molekularen Gases deutet darauf hin, dass tatsächlich<br />
Gas durch Stoßwellen entlang der Vorderseiten dieses<br />
rotierenden Nahinfrarot-Balkens in die zentralen ~30<br />
pc gelenkt wird. Eine genauere Auswertung ist nötig,<br />
um die möglichen Einströmraten in das unmittelbare<br />
Zentrum abschätzen zu können. Die hohe Extinktion <strong>und</strong><br />
die Existenz mehrerer junger Sternentstehungsgebiete<br />
innerhalb der zentralen 100 pc machen diese Galaxie<br />
jedoch zu einem idealen Objekt, um das Wechselspiel<br />
zwischen Gasdynamik <strong>und</strong> Sternentstehung zu untersuchen.<br />
Sind sich alle Galaxienzentren ähnlich? Das<br />
Schlüsselprojekt NUGA am PdBI des IRAM<br />
Das Galaxienkern-Projekt NUGA (Nuclei of Galaxies<br />
project) ist die erste CO-Durchmusterung nahegelege-<br />
ner aktiver Galaxienzentren mit einer Auflösung unter<br />
einer Bogensek<strong>und</strong>e. NUGA ist eine im Wesentlichen europäische<br />
Kollaboration zwischen Wissenschaftlern folgender<br />
Einrichtungen: MPIA, MPE, MPIfR, Universität<br />
Köln, Nationales Astronomisches Observatorium Spaniens,<br />
Observatoire de Paris, CSIC/Spain, <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Ra-<br />
dioastronomie in Italien <strong>und</strong> Astronomisches <strong>Institut</strong><br />
Basel.<br />
Mit NUGA sollen die verschiedenen Mechanismen der<br />
Gaszufuhr in aktive Galaxienzentren systematisch unter-<br />
III.4 Brennstoff <strong>für</strong> die zentrale Kiloparsec-Region oder: Wie aktiviert man Galaxiezentren? 73<br />
sucht werden. Bei einer sorgfältig ausgewählten Stichprobe<br />
naher AGN, die sämtliche Stadien der Kernaktivität<br />
überdeckt (Seyfert-Galaxien, LINERS, Starburst-Galaxien<br />
<strong>und</strong> Übergangsobjekte), wurde die Kinematik des molekularen<br />
Gases bei 1 mm <strong>und</strong> 3 mm mit maximaler<br />
Winkelauflösung (~ 0.5 Bogensek<strong>und</strong>en) <strong>und</strong> spektraler<br />
Auflösung (3-6 km/s) abgebildet. Aufgr<strong>und</strong> der zehnmal<br />
höheren Empfindlichkeit gegenüber anderen Millimeter-<br />
Durchmusterungen liefern die NUGA-Daten einzigartige<br />
Informationen über die Kinematik innerhalb der innersten<br />
Bogenminute der jeweiligen Galaxie.<br />
Bislang war es stets schwierig, statistische Beweise<br />
<strong>für</strong> die Rolle zu finden, die großräumige Balken <strong>und</strong><br />
Störungen durch gravitative Wechselwirkungen bei der<br />
Brennstoffzufuhr in AGN spielen. Der Gr<strong>und</strong> da<strong>für</strong><br />
ist, dass diese großräumigen Störungen Zeitskalen aufweisen,<br />
die erheblich länger sind als die, welche die<br />
Einschaltdauer der AGN kennzeichnen. Jede mögliche<br />
Korrelation muss daher sehr viel näher am Kern gesucht<br />
werden, in sek<strong>und</strong>ären Erscheinungsformen, die<br />
in den großräumigen (auf kpc-Skalen) eingebettet sind.<br />
Daher sind Beobachtungen mit hoher Auflösung (unter 1<br />
Bogensek<strong>und</strong>e) nötig, um die Verteilung <strong>und</strong> Kinematik<br />
des molekularen Gases in der Umgebung von AGN korrekt<br />
abzuleiten.<br />
Unsere ersten CO-Aufnahmen von NUGA-Objekten<br />
zeigen eine vielfältige Morphologie bei den zirkumnuklearen<br />
Scheiben von AGN-Wirtsgalaxien (siehe Abb.<br />
III.4.5). Auf verschiedenen räumlichen Skalen wurden<br />
unterschiedliche Gravitationsinstabilitäten identifiziert.<br />
In einigen Galaxien findet man mehrere nebeneinander<br />
bestehende Störungen, während andere hauptsächlich nur<br />
einen Instabilitätstyp aufweisen. Die meisten Störungen,<br />
die in den Kernscheiben der NUGA-Objekte beobachtet<br />
wurden, stehen mit selbstgravitierenden Gasinstabilitäten<br />
in Zusammenhang.<br />
Die Vielfalt der Kinematik des Kerngases kann grob<br />
wie folgt klassifiziert werden:<br />
(a) m = 1 Instabilitäten, die als einarmige Spiralen<br />
oder schräg liegende Scheiben auftreten <strong>und</strong> sich<br />
auf mehrfachen Skalen entwickeln, von etlichen<br />
zig bis zu etlichen h<strong>und</strong>ert Parsec.<br />
(b) m = 2 Instabilitäten, welche die typischen zweiarmigen<br />
Spiralwellen (die so genannten Zwillingsspitzen)<br />
oder Gasbalken entwickeln, von denen<br />
man annimmt, dass sie sich in den Potentialen stel-<br />
larer Balken ausbilden.<br />
(c) Ringe <strong>und</strong> stochastische Spiralen, die mit nichtselbstgravitierenden<br />
Instabilitäten zusammenhän-<br />
gen.<br />
Eine Schlüsselfrage, die aus diesen Ergebnissen folgt,<br />
lautet, ob die dynamischen Merkmale des Kerns/Zentrums<br />
von den Eigenschaften der Wirtsgalaxie abhängen,<br />
d.h. ob sich die Eigenschaften der großräumigen<br />
Scheiben im Kern widerspiegeln (gleiche Moden wie<br />
in der Kernregion). Dies würde darauf hindeuten, dass<br />
die Moden im Kern von großräumigen Antriebskräften