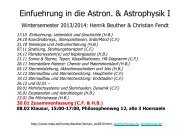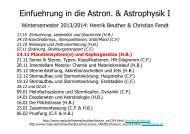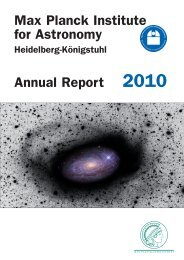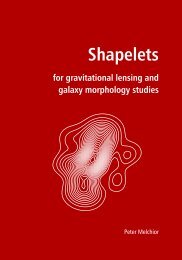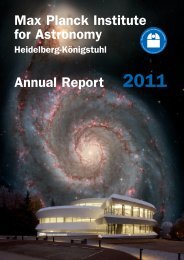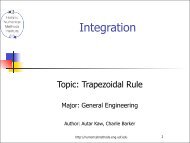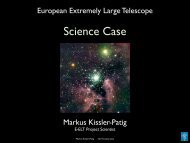V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
III.2 Staub im Computer: Numerisches zur Entstehung von Planeten<br />
Teleskope sind das klassische Arbeitsmittel der Astro-<br />
nomen. Doch man kann nicht alle Vorgänge am Himmel<br />
durch Beobachtung alleine verstehen. Wichtige Prozesse,<br />
wie zum Beispiel die Entstehung von Planeten aus<br />
der Zusammenlagerung mikroskopischer Staubkörner,<br />
verschließen sich der direkten Beobachtung. Hier kommen<br />
Computersimulationen ins Spiel, die von ihren<br />
Entwicklern auch gerne »numerische Teleskope« genannt<br />
werden. Am <strong>Max</strong>-<strong>Planck</strong>-<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Astronomie</strong><br />
in Heidelberg werden eine Vielzahl solcher Werkzeuge<br />
entwickelt <strong>und</strong> erfolgreich bei der Planung <strong>und</strong> Interpretation<br />
von Beobachtungen auf dem Gebiet der<br />
Planetenentstehung eingesetzt.<br />
<strong>Astronomie</strong> am Teleskop <strong>und</strong> am Computer<br />
Die Untersuchung des Prozesses der Sternentstehung<br />
war einer der Schwerpunkte der astrophysikalischen For-<br />
schung der letzten zwanzig Jahre. Im Fall sehr massereicher<br />
Sterne mit Massen oberhalb von zehn Sonnenmassen<br />
sind noch viele Fragen unbeantwortet. Dies liegt vor<br />
allem an der relativen Seltenheit <strong>und</strong> der kurzen Dauer<br />
ihrer Entstehung, was ihre Beobachtbarkeit stark einschränkt.<br />
Für die viel häufigeren Sterne mittlerer <strong>und</strong><br />
geringer Masse ist inzwischen jedoch ein sehr gutes<br />
Verständnis der wichtigsten Prozesse der Sternentstehung<br />
erreicht worden. Sterne dieses Massenbereiches sind vor<br />
allem deshalb von herausragender Bedeutung, da sich<br />
an ihnen beispielhaft die Entwicklung unseres eigenen<br />
Sonnensystems <strong>und</strong> damit die Entstehung von Planeten<br />
wie Jupiter, aber auch die unseres Heimatplaneten Erde<br />
studieren lässt.<br />
<strong>Astronomie</strong> umfasst immer zwei Teilbereiche, welche<br />
Hand in Hand gehen müssen. Einerseits muss der beobachtende<br />
Astronom Sterne <strong>und</strong> andere kosmische<br />
Objekte in ihren Strahlungserscheinungen vermessen. An-<br />
dererseits muss der theoretische Astrophysiker diese Beobachtungen<br />
mit auf der Erde experimentell bestimmten<br />
Naturgesetzen zu erklären suchen. Schon Mitte des letzten<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts zeigte sich, dass sich beispielsweise die<br />
Entwicklung eines Sterns nicht als Ergebnis einer einfachen<br />
Gleichung niederschreiben lässt. Aufwendige numerische<br />
Simulationen auf den damaligen noch mit Röh-<br />
ren bewaffneten Großrechnern waren notwendig <strong>und</strong> man<br />
freute sich als man es schaffte, die verschiedenen Ent-<br />
wicklungsstadien von Sternen im Computer mit den Beobachtungen<br />
von echten Sternen in Übereinstimmung zu<br />
bringen. Alles, was wir heute über Masse, Zusammensetzung<br />
<strong>und</strong> Alter eines Sterns wissen, stammt aus solchen<br />
ausgefeilten numerischen Experimenten.<br />
Die Entdeckung des ersten extrasolaren Planeten bei<br />
einem sonnenähnlichen Stern mit dem Namen 51 Pegasi<br />
im Jahre 1995 war ein echter Schock <strong>für</strong> die Theoretiker.<br />
Was man damals fand, war ein Gasriese von der Größe<br />
Jupiters auf einer Umlaufbahn näher am Zentralstern,<br />
als Merkur an der Sonne! Hatte man bis dato die Modelle<br />
zur Planetenentstehung an den Gegebenheiten in<br />
unserem Heimatsystem ausgerichtet, so musste man nun<br />
umdenken. Bei uns befinden sich die erdähnlichen Planeten<br />
auf niedrigen Umlaufbahnen, <strong>und</strong> die Gasriesen<br />
wie Jupiter <strong>und</strong> Saturn umlaufen die Sonne weit draußen<br />
in großer Entfernung. Dies erschien natürlich, da es wäh-<br />
rend der Planetenentstehung nah an der Sonne stets<br />
wärmer war als weiter außen. Jupiter, welcher fünfmal<br />
so weit von der Sonne entfernt ist wie die Erde, befindet<br />
sich jenseits der sogenannten »Schneegrenze«. Das ist<br />
die Entfernung von der Sonne, ab der das Gas <strong>und</strong> der<br />
Staub, aus dem die Planeten entstehen, so kalt sind, dass<br />
Moleküle wie zum Beispiel Wasser ausfrieren können,<br />
wodurch sich die zur Verfügung stehende Materialmenge<br />
zur Entstehung von Jupiter beträchtlich erhöht. Die<br />
Beobachtungsfakten, also die kleinen Planeten Venus,<br />
Erde <strong>und</strong> Mars innen <strong>und</strong> die weit massereicheren Planeten<br />
Jupiter, Saturn <strong>und</strong> die Eisplaneten Uranus <strong>und</strong><br />
Neptun weit außen, wurden als allgemein gültig angesehen<br />
<strong>und</strong> waren Gr<strong>und</strong>lage aller Erklärungsversuche von<br />
Kant <strong>und</strong> Laplace über Weizsäcker <strong>und</strong> Savronov bis hin<br />
zu den modernen, auf detaillierten Computersimulationen<br />
beruhenden Modellen der letzten Jahre von Pollack <strong>und</strong><br />
Boss. In all diesen Modellen geht man davon aus, dass<br />
die junge Sonne einst von einem Gas- <strong>und</strong> Staubgemisch<br />
umgeben war, welches ähnlich den Saturnringen in einer<br />
flachen Scheibe um den Stern verteilt war. Ausdehnung<br />
<strong>und</strong> Umlaufgeschwindigkeiten entsprechen dabei dem<br />
heutigen Sonnensystem. Die Modelle unterscheiden sich<br />
lediglich darin, wie die Planeten im Einzelnen aus diesem<br />
Urnebel auskondensierten.<br />
Was nun den meisten Theoretikern seit der Entdeckung<br />
von 51 Pegasi b immense Kopfschmerzen breitet, nämlich<br />
zu erklären, warum es massereiche Gasriesen auf niedrigen<br />
Umlaufbahnen, so genannte »Heiße Jupiter«, geben<br />
kann, war <strong>für</strong> zumindest einige wenige Forscher eine große<br />
Freude. Hatten sie doch schon in den 80er Jahren eine radiale<br />
Wanderung von jungen Planeten proklamiert. Diese<br />
Wanderung resultiert aus der Wirkung der Schwerkraft<br />
des Planeten auf die Gas- <strong>und</strong> Staubscheibe sowie auf der<br />
entsprechenden Rückwirkung auf den Planeten. Dieser<br />
Theorie wurde zunächst wenig Beachtung geschenkt, da<br />
man ja in unserem Planetensystem keinerlei Hinweise<br />
auf eine solche Wanderung fand. Unsere Planeten scheinen<br />
sich alle da zu befinden, wo sie auch einst entstan-<br />
51