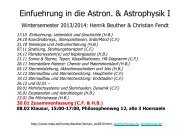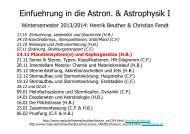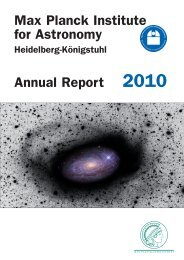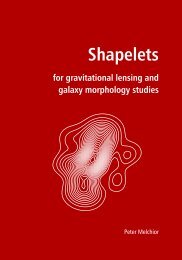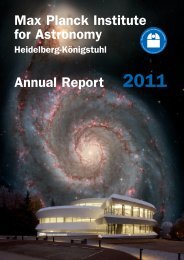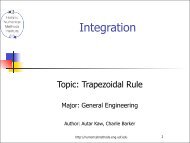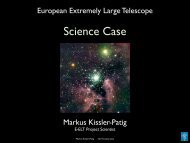V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6<br />
I. Allgemeines<br />
I.1 Wissenschaftliche Zielsetzung<br />
Das <strong>Max</strong>-<strong>Planck</strong>-<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Astronomie</strong> (Abb. I.1)<br />
widmet sich seit seiner Gründung 1967 der Erforschung<br />
des Universums im optischen <strong>und</strong> infraroten Spektralbereich.<br />
Neben der Konzeption, Durchführung, Auswertung<br />
<strong>und</strong> Interpretation von Beobachtungsprogrammen werden<br />
am MPIA, meist im Rahmen großer internationaler<br />
Kollaborationen, Teleskope <strong>und</strong> Beobachtungsinstrumente<br />
geplant <strong>und</strong> gebaut.<br />
Zwei Schwerpunkte haben sich in der wissenschaftlichen<br />
Forschung am <strong>Institut</strong> herauskristallisiert: einerseits<br />
die Entstehung von Sternen <strong>und</strong> Planeten, andererseits<br />
die beobachtende Kosmologie, insbesondere die Frage<br />
nach der Entstehung <strong>und</strong> Entwicklung von Galaxien.<br />
Wenngleich diese beiden Bereiche in Bezug auf die<br />
Gegenstände der Forschung voneinander getrennt sind,<br />
gibt es doch viele Berührungspunkte. So ist beispielsweise<br />
die Sternentstehung im jungen Universum eng mit<br />
der Entstehung <strong>und</strong> Entwicklung der Galaxien verknüpft.<br />
Beobachtungen mit den besten verfügbaren Instrumenten<br />
einerseits <strong>und</strong> Computersimulationen der am <strong>Institut</strong><br />
arbeitenden Theoriegruppen andererseits bilden die<br />
Gr<strong>und</strong>lage des wissenschaftlichen Fortschritts.<br />
Entstehung von Sternen <strong>und</strong> Planeten<br />
Die ersten Phasen der Sternentstehung spielen sich<br />
im Inneren dichter Molekülwolken ab <strong>und</strong> bleiben aufgr<strong>und</strong><br />
der davor befindlichen Staubteilchen im sichtbaren<br />
Licht unseren Blicken verborgen. Infrarotstrahlung<br />
vermag jedoch den Staub zu durchdringen, weswegen<br />
sich die Frühstadien der Sternentstehung in diesem<br />
Wellenlängenbereich bevorzugt studieren lassen. Hier<br />
geben auch die kalte Interstellare Materie <strong>und</strong> die aus<br />
ihr laufend neu entstehenden Sterne <strong>und</strong> Planeten den<br />
größten Teil ihrer Strahlung ab. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e hat<br />
sich der Schwerpunkt astronomischer Beobachtungen am<br />
MPIA in der jüngeren Vergangenheit immer mehr vom<br />
optischen zum infraroten Spektralbereich verlagert.<br />
Mit ISOPHOT sowie mit Submillimeterteleskopen ließen<br />
sich im Innern großer Staubwolken sehr kalte <strong>und</strong><br />
dichte Gebiete nachweisen – protostellare Kerne, die kurz<br />
Abb. I.1: Das <strong>Max</strong>-<strong>Planck</strong>-<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Astronomie</strong> auf dem<br />
Königstuhl in Heidelberg.