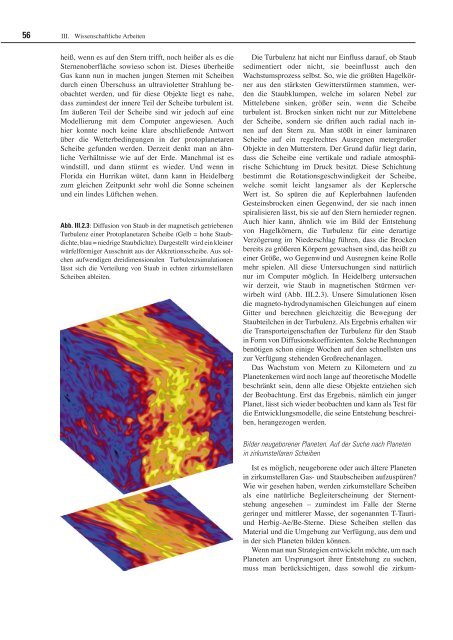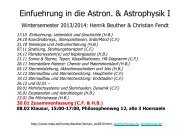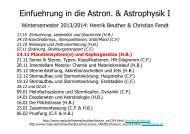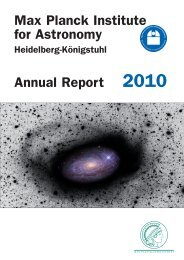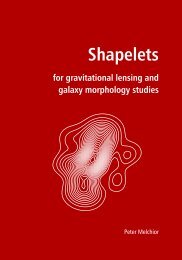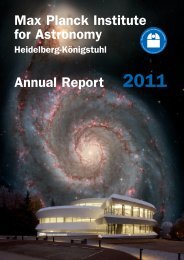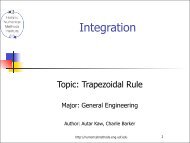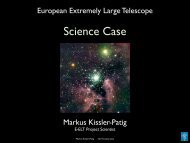V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
56 III. Wissenschaftliche Arbeiten<br />
heiß, wenn es auf den Stern trifft, noch heißer als es die<br />
Sternenoberfläche sowieso schon ist. Dieses überheiße<br />
Gas kann nun in machen jungen Sternen mit Scheiben<br />
durch einen Überschuss an ultravioletter Strahlung beobachtet<br />
werden, <strong>und</strong> <strong>für</strong> diese Objekte liegt es nahe,<br />
dass zumindest der innere Teil der Scheibe turbulent ist.<br />
Im äußeren Teil der Scheibe sind wir jedoch auf eine<br />
Modellierung mit dem Computer angewiesen. Auch<br />
hier konnte noch keine klare abschließende Antwort<br />
über die Wetterbedingungen in der protoplanetaren<br />
Scheibe gef<strong>und</strong>en werden. Derzeit denkt man an ähnliche<br />
Verhältnisse wie auf der Erde. Manchmal ist es<br />
windstill, <strong>und</strong> dann stürmt es wieder. Und wenn in<br />
Florida ein Hurrikan wütet, dann kann in Heidelberg<br />
zum gleichen Zeitpunkt sehr wohl die Sonne scheinen<br />
<strong>und</strong> ein lindes Lüftchen wehen.<br />
Abb. III.2.3: Diffusion von Staub in der magnetisch getriebenen<br />
Turbulenz einer Protoplanetaren Scheibe (Gelb = hohe Staubdichte,<br />
blau = niedrige Staubdichte). Dargestellt wird ein kleiner<br />
würfelförmiger Ausschnitt aus der Akkretionsscheibe. Aus solchen<br />
aufwendigen dreidimensionalen Turbulenzsimulationen<br />
lässt sich die Verteilung von Staub in echten zirkumstellaren<br />
Scheiben ableiten.<br />
Die Turbulenz hat nicht nur Einfluss darauf, ob Staub<br />
sedimentiert oder nicht, sie beeinflusst auch den<br />
Wachstumsprozess selbst. So, wie die größten Hagelkörner<br />
aus den stärksten Gewitterstürmen stammen, werden<br />
die Staubklumpen, welche im solaren Nebel zur<br />
Mittelebene sinken, größer sein, wenn die Scheibe<br />
turbulent ist. Brocken sinken nicht nur zur Mittelebene<br />
der Scheibe, sondern sie driften auch radial nach innen<br />
auf den Stern zu. Man stößt in einer laminaren<br />
Scheibe auf ein regelrechtes Ausregnen metergroßer<br />
Objekte in den Mutterstern. Der Gr<strong>und</strong> da<strong>für</strong> liegt darin,<br />
dass die Scheibe eine vertikale <strong>und</strong> radiale atmosphärische<br />
Schichtung im Druck besitzt. Diese Schichtung<br />
bestimmt die Rotationsgeschwindigkeit der Scheibe,<br />
welche somit leicht langsamer als der Keplersche<br />
Wert ist. So spüren die auf Keplerbahnen laufenden<br />
Gesteinsbrocken einen Gegenwind, der sie nach innen<br />
spiralisieren lässt, bis sie auf den Stern hernieder regnen.<br />
Auch hier kann, ähnlich wie im Bild der Entstehung<br />
von Hagelkörnern, die Turbulenz <strong>für</strong> eine derartige<br />
Verzögerung im Niederschlag führen, dass die Brocken<br />
bereits zu größeren Körpern gewachsen sind, das heißt zu<br />
einer Größe, wo Gegenwind <strong>und</strong> Ausregnen keine Rolle<br />
mehr spielen. All diese Untersuchungen sind natürlich<br />
nur im Computer möglich. In Heidelberg untersuchen<br />
wir derzeit, wie Staub in magnetischen Stürmen verwirbelt<br />
wird (Abb. III.2.3). Unsere Simulationen lösen<br />
die magneto-hydrodynamischen Gleichungen auf einem<br />
Gitter <strong>und</strong> berechnen gleichzeitig die Bewegung der<br />
Staubteilchen in der Turbulenz. Als Ergebnis erhalten wir<br />
die Transporteigenschaften der Turbulenz <strong>für</strong> den Staub<br />
in Form von Diffusionskoeffizienten. Solche Rechnungen<br />
benötigen schon einige Wochen auf den schnellsten uns<br />
zur Verfügung stehenden Großrechenanlagen.<br />
Das Wachstum von Metern zu Kilometern <strong>und</strong> zu<br />
Planetenkernen wird noch lange auf theoretische Modelle<br />
beschränkt sein, denn alle diese Objekte entziehen sich<br />
der Beobachtung. Erst das Ergebnis, nämlich ein junger<br />
Planet, lässt sich wieder beobachten <strong>und</strong> kann als Test <strong>für</strong><br />
die Entwicklungsmodelle, die seine Entstehung beschreiben,<br />
herangezogen werden.<br />
Bilder neugeborener Planeten. Auf der Suche nach Planeten<br />
in zirkumstellaren Scheiben<br />
Ist es möglich, neugeborene oder auch ältere Planeten<br />
in zirkumstellaren Gas- <strong>und</strong> Staubscheiben aufzuspüren?<br />
Wie wir gesehen haben, werden zirkumstellare Scheiben<br />
als eine natürliche Begleiterscheinung der Sternentstehung<br />
angesehen – zumindest im Falle der Sterne<br />
geringer <strong>und</strong> mittlerer Masse, der sogenannten T-Tauri-<br />
<strong>und</strong> Herbig-Ae/Be-Sterne. Diese Scheiben stellen das<br />
Material <strong>und</strong> die Umgebung zur Verfügung, aus dem <strong>und</strong><br />
in der sich Planeten bilden können.<br />
Wenn man nun Strategien entwickeln möchte, um nach<br />
Planeten am Ursprungsort ihrer Entstehung zu suchen,<br />
muss man berücksichtigen, dass sowohl die zirkum-