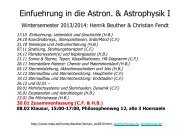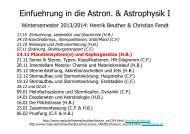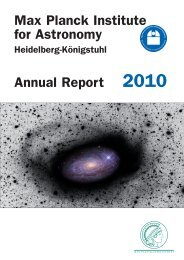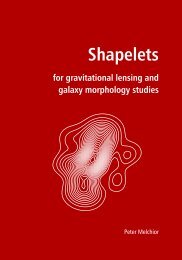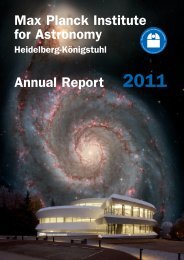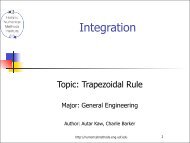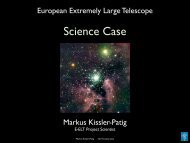V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
44 III. Wissenschaftliche Arbeiten<br />
Brauner Zwerge auf diese Weise zu bilden (da derartig<br />
schwach geb<strong>und</strong>ene Systeme beim Ausschleudern eher<br />
auseinandergerissen würden).<br />
Um dies zu überprüfen, wurden mit Hilfe der N-Körper-<br />
Simulationen die Dichteprofile <strong>und</strong> die Lebensdauer von<br />
Scheiben um Braune Zwerge vorhergesagt. Die Frage ist,<br />
ob man sehr enge BZ-Doppelsterne durch Ausstoßung<br />
bilden <strong>und</strong> doch genügend große Scheiben um die einzelnen<br />
ausgestoßenen Braune Zwerge zurückbehalten kann,<br />
um sie in einem typischen Alter von 1–5 Millionen Jahren<br />
beobachten zu können. Die Simulationen haben ergeben,<br />
dass die Scheiben direkt nach einer nahen Begegnung (die<br />
zur Ausstoßung führt) stark gestutzt sind <strong>und</strong> ihre Größe<br />
sehr gering ist, meistens unter 5 AE. Außerdem liegen die<br />
Scheibenmassen gewöhnlich unter einer Jupitermasse.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der allgemein niedrigen Akkretionsraten von<br />
BZ-Scheiben sollten jedoch mindestens 12 % dieser<br />
Scheiben sehr geringer Masse länger als 1 Million Jahre<br />
überleben. Daher sollte der Anteil der Braunen Zwerge<br />
mit Scheiben unter den jüngsten BZ zwar gering aber<br />
nicht vernachlässigbar sein; überdies sollte er größer sein,<br />
wenn sich weite BZ-Doppelsysteme bilden können. Diese<br />
Vorhersage kann durch Beobachtungen überprüft werden.<br />
Zusätzlich zu den Eigenschaften der Scheiben <strong>und</strong><br />
der Doppelstern-Statistik kann man Hinweise auf das<br />
Ausstoßungs-Szenarium auch durch die Beobachtung<br />
des kinematischen Verhaltens von Braunen Zwergen in<br />
jungen Assoziationen <strong>und</strong> Sternentstehungsgebieten erhalten.<br />
Wenn das Ausstoßungs-Szenarium den wichtigsten<br />
Entstehungsmechanismus darstellt, würden wir auch erwarten,<br />
dass man Braune Zwerge in der Nähe massearmer<br />
Protosterne (so genannter Objekte der Klasse 0) beobachtet.<br />
Scheiben um Braune Zwerge<br />
Einen Hinweis auf die Natur <strong>und</strong> die Entstehung von<br />
Braunen Zwergen könnte die offenbare Ähnlichkeit junger<br />
Brauner Zwerge mit klassischen T-Tauri-Sternen (die<br />
Vorhauptreihenphase massearmer Sterne) liefern. Jüngste<br />
spektroskopische Durchmusterungen weisen darauf hin,<br />
dass junge Braune Zwerge bis hinab zu Massen nahe der<br />
Grenze <strong>für</strong> Deuteriumbrennen (13 M Jupiter ) T-Tauri-ähnliche<br />
Scheibenakkretion zeigen, wobei Strahlung in der<br />
Ha-Linie als Indikator <strong>für</strong> Akkretion dient. Allgemein<br />
scheint die Akkretionsrate sehr rasch mit der Masse<br />
abzufallen (die Akkretionsrate ist in etwa proportional<br />
zu M 2 ) <strong>und</strong> mit dem Alter deutlich abzunehmen. Die gemessenen<br />
Akkretionsraten betragen manchmal nur 10 –12<br />
M Sonne /Jahr. Die Tatsache, dass es über die Massengrenze<br />
<strong>für</strong> Wasserstoffbrennen hinweg keine Diskontinuität<br />
in der Beziehung zwischen den Akkretionsraten <strong>und</strong><br />
Masse gibt, deutet auf einen gemeinsamen Scheiben-<br />
Akkretionsprozess <strong>für</strong> Braune Zwerge <strong>und</strong> klassische<br />
T-Tauri-Sterne hin, bei dem möglicherweise auch<br />
Magnetfelder eine entscheidende Rolle spielen.<br />
Der nächste Schritt ist, nach direkten Anzeichen <strong>für</strong><br />
Scheiben um Braune Zwerge zu suchen <strong>und</strong> ihre Massen<br />
zu bestimmen. Wie bei den T-Tauri-Sternen hat man<br />
erste Hinweise auf Scheiben um Braune Zwerge bei<br />
Durchmusterungen im nahen Infarot erhalten, die einen<br />
Strahlungsüberschuss über das erwartete photosphärische<br />
Niveau hinaus anzeigen. Ein noch besserer Indikator ist<br />
erhöhte Emission bei Wellenlängen um 10 mm, erzeugt<br />
durch warmen zirkumstellaren Staub. Der erste Nachweis<br />
von Braunen Zwergen bei diesen Wellenlängen geschah<br />
durch ISOCAM-Breitbandbeobachtungen in den Sternentstehungsgebieten<br />
Chamaeleon I <strong>und</strong> Rho Ophiuchi, die<br />
mit dem Infrared Space Observatory durchgeführt wurden.<br />
Zusammen mit unseren früheren Studenten Daniel<br />
Apai <strong>und</strong> Ilaria Pascucci (jetzt an der University of<br />
Arizona) sowie Michael Sterzik von der ESO haben wir<br />
mit Hilfe bodengeb<strong>und</strong>ener Teleskope nach der Strahlung<br />
Brauner Zwerge im mittleren Infrarotbereich gesucht, insbesondere<br />
nach der charakteristischen Emissionsbande<br />
von Silikaten bei 10 mm. Diese Bande hat ein enormes<br />
analytisches Potential, da sie sowohl die optische Tiefe<br />
des emittierenden Materials als auch die Größe der<br />
Staubkörner anzeigt. Im Falle des jungen BZ-Kandidaten<br />
Cha Ha 2 fanden wir einen klaren Hinweis auf thermische<br />
Staubemission. Überraschenderweise zeigt das<br />
Objekt keinerlei Silikat-Emissionsbande, was entweder<br />
auf eine ziemlich flache Scheibengeometrie oder auf<br />
beachtliches Staubwachstum hindeutet. Im Falle des<br />
jungen (etwa 1 Million Jahre alten), sicher identifizierten<br />
Braunen Zwergs CFHT-BD-Tau 4 hatten wir mehr<br />
Glück. Mit Hilfe des T-ReCs-Instruments am Gemini-<br />
Süd-8-m-Teleskop gelang es uns, die charakteristische<br />
Silikat-Emissionsbande zu finden, welche die Existenz<br />
einer optisch dünnen Scheibenschicht beweist, ähnlich<br />
wie wir sie bei T-Tauri-Sternen beobachten. Eine genauere<br />
Analyse des Spektrums ergab einen ersten Hinweis auf<br />
Staubwachstum <strong>und</strong> sogar <strong>für</strong> die Ablagerung von Staub<br />
in der Scheibe dieses Objekts.<br />
Die nächste Herausforderung bestand darin, die<br />
Strahlung dieser Scheiben im Millimeterbereich nachzuweisen.<br />
Diese ist ein direktes Maß <strong>für</strong> die Masse<br />
der Scheibe, wobei jedoch die Opazität des Staubs<br />
bekannt sein muss. Mit Hilfe des SCUBA-Bolometers<br />
am JCMT-Submillimeter-Teleskop auf Hawaii <strong>und</strong><br />
des MAMBO-Arrays am IRAM-30-m-Teleskop auf dem<br />
Pico Veleta (Spanien) entdeckten wir zum ersten Mal<br />
Millimeteremission von zwei jungen Braunen Zwergen<br />
bei einem Flussniveau von einigen Millijansky. Unter<br />
der Annahme ähnlicher Staubopazitäten, wie sie bei der<br />
Abschätzung der Scheibenmasse bei T-Tauri-Sternen<br />
verwendet werden, erhielten wir <strong>für</strong> die Gesamtmassen<br />
der Scheiben Werte von einigen Jupitermassen. Dieses<br />
überraschende Ergebnis deutet auf die Möglichkeit hin,<br />
dass sich in den Scheiben um Braune Zwerge sogar<br />
Planeten bilden könnten.<br />
Interessant ist, dass es eine Reihe von Quellen mit<br />
überschüssiger, von einer Scheibe stammenden Infrarot-