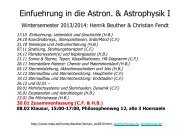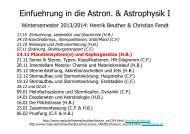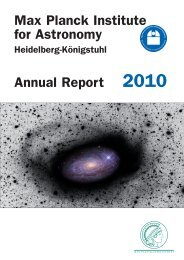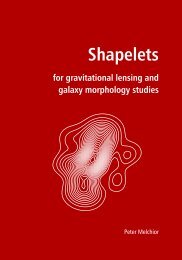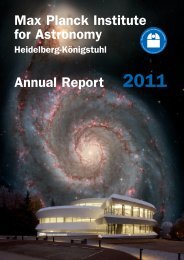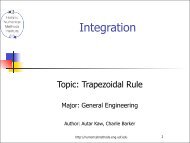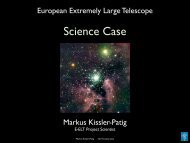V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
42 III. Wissenschaftliche Arbeiten<br />
ment Wasserstoff ist). Dadurch entstehen sehr charakteristische<br />
Spektren, die in zwei breite Spek-tralklassen unterteilt<br />
wurden. Die erste Klasse, »L« genannt, ist durch<br />
Metallhydrid-Linien (z.B. CrH <strong>und</strong> FeH) <strong>und</strong> neutrale<br />
Alkalimetalle (Na, K, Rb, Cs) in ihren roten optischen<br />
Spektren (0.6 –1.0 mm) gekennzeichnet. Die zweite<br />
Klasse, »T«, kann durch starke Wasser- <strong>und</strong> insbesondere<br />
Methanbanden im nahen Infrarotspektrum (1–2.5 mm)<br />
identifiziert werden. Gl 229B ist der Prototyp der T-<br />
Zwerge. Die Zuordnung von Effektivtemperaturen zu diesen<br />
Spektralklassen ist wegen der komplexen Chemie <strong>und</strong><br />
der möglichen Dynamik in ihren Atmosphären schwierig,<br />
wie später noch besprochen werden wird. Aber in groben<br />
Zügen überdecken die L-Zwerge den Temperaturbereich<br />
von 2100 bis 1300 K <strong>und</strong> die T-Zwerge den von 1300<br />
bis 600 K. »L«- <strong>und</strong> »T«-Typen sind damit die kühlere<br />
Fortsetzung der bekannten Spektralklassensequenz<br />
OBAFGKM. (Bei der Beschreibung ihrer spektralen<br />
Abb. III.1.3: Spektren ultrakühler Zwerge im nahen Infrarot. Die<br />
Spektralklassensequenz wird von oben nach unten durchschritten,<br />
von den späten M-Zwergen (M6) zu den späten L-Zwergen<br />
(L7). Ultrakühle Zwerge geben den Großteil ihrer Strahlung<br />
zwischen 1 <strong>und</strong> 2.5 mm ab. Markante Molekülbanden sind gekennzeichnet.<br />
(Aus Leggett et al. ApJ, 548, 908, 2001).<br />
Relativer spektraler Fluss F l<br />
TiO<br />
H 2 O<br />
Na <br />
FeH<br />
K K <br />
H2O H 2 O<br />
Energieverteilung bezeichnen wir M-, L- <strong>und</strong> T-Zwerge<br />
gemeinsam als »ultrakühle Zwerge«. Welcher Masse<br />
eine bestimmte Spektralklasse entspricht – d.h. ob es ein<br />
massearmer Stern oder ein Brauner Zwerg ist – hängt<br />
vom Alter ab. Der Gr<strong>und</strong> hier<strong>für</strong> ist, dass Braune Zwerge<br />
sich mit der Zeit abkühlen <strong>und</strong> somit beim Altern immer<br />
spätere Spektraltypen erreichen.)<br />
Wie durch das Fehlen eines merklichen nuklearen<br />
Brennens definiert, besitzen Braune Zwerge Massen<br />
von weniger als etwa 0.075 M Sonne (entsprechend etwa<br />
80 M Jupiter ). Bei noch geringeren Massen erreicht man<br />
den Bereich der extrasolaren Planeten, von denen inzwischen<br />
r<strong>und</strong> 150 entdeckt wurden. Ihre Massen liegen<br />
zwischen der des Saturn <strong>und</strong> mehreren Jupitermassen.<br />
Bedeutet dies, dass es ein Kontinuum zwischen Planeten<br />
<strong>und</strong> Sternen gibt? Ja <strong>und</strong> nein. Jedes gasförmige Objekt,<br />
das kein Wasserstoffbrennen zünden kann, nennen wir<br />
ein »Objekt substellarer Masse«. Planeten wie Braune<br />
Zwerge sind demnach Objekte substellarer Masse.<br />
Allgemein wird ein Planet definiert als Körper, der sich<br />
in einer Akkretionsscheibe um einen Stern aus den vom<br />
Sternentstehungsprozess übrig gebliebenen Trümmern<br />
bildet. Sterne andererseits bilden sich beim Kollaps<br />
einer Gaswolke im interstellaren Medium. Objekte,<br />
die auf diese Weise entstanden, aber zu wenig Masse<br />
H 2 O<br />
LHS 429 M7<br />
LHS 2065 M9<br />
LP 944 – 20 M9<br />
DNS 1058 L3<br />
DNS 1228AB L5<br />
DNS 0205AB L7<br />
CO<br />
H2O 1 1.5 2 2.5<br />
Wellenlänge [µm]