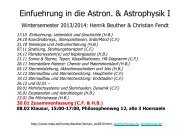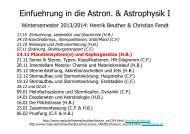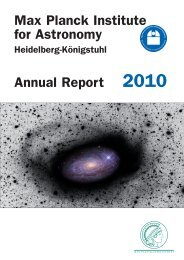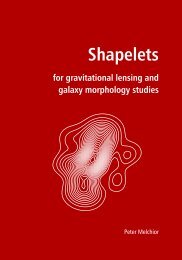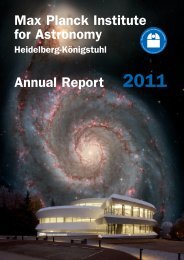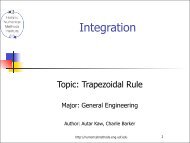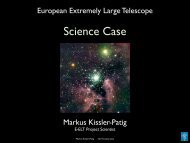V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
20 II. Highlights<br />
18°1402<br />
Dec (J2000)<br />
01<br />
00<br />
1359<br />
58<br />
57<br />
56<br />
55<br />
54<br />
53<br />
25°5236<br />
Dec (J2000)<br />
g) HL Tau<br />
4 h 31 m 38. s 7 38. s 6<br />
35<br />
34<br />
33<br />
32<br />
31<br />
30<br />
29<br />
28<br />
27<br />
i)<br />
UZ Tau E<br />
4 h 32 m 43. s 4 43. s 3<br />
38. s 5 38. s 4 38. s 3 38. s 2 38. s 1<br />
UZ Tau W<br />
43. s 2 43. s 1 43. s 0 42. s 9 42. s 8 42. s 7<br />
RA (J2000)<br />
Kollegen aus den USA beobachteten im Berichtsjahr<br />
14 massearme Vor-Hauptreihensterne (so genannte<br />
T-Tauri-Sterne) bei 7 mm Wellenlänge. Sie befinden<br />
sich in dem 140 pc (460 Lj) entfernten Taurus-Auriga-<br />
Komplex, ihr Alter liegt im Bereich von 100 000 bis<br />
drei Millionen Jahren. Die Massen von 13 Sternen dieser<br />
Gruppe liegen zwischen 0.5 <strong>und</strong> 0.7 Sonnenmassen,<br />
nur einer (RY Tau) ist mit 1.7 Sonnenmassen erheblich<br />
massereicher. Bei allen 14 Sternen ließ sich Emission<br />
bei 7 mm Wellenlänge nachweisen, bei zehn von ihnen<br />
konnte die Scheibe sogar wie erhofft räumlich aufgelöst<br />
werden. Ihre Größen liegen zwischen 100 <strong>und</strong> 200<br />
Aastronomieschen Einheiten (Abb. II.1.2).<br />
Bevor die Messdaten interpretiert werden konnten,<br />
musste noch ein Störeffekt berücksichtigt werden. T-<br />
Tauri-Sterne weisen starke Sternwinde auf, die in ihrer<br />
Umgebung Bremsstrahlung erzeugen. Diese tritt zwar<br />
vorwiegend bei Wellenlängen im Zentimeterbereich<br />
auf, trägt aber auch zur Millimeter-Emission bei <strong>und</strong><br />
überlagert somit die Strahlung des Staubes. Um diesen<br />
28°2640<br />
39<br />
38<br />
37<br />
36<br />
35<br />
34<br />
33<br />
32<br />
31<br />
30°2204<br />
03<br />
02<br />
01<br />
00<br />
2159<br />
58<br />
57<br />
56<br />
55<br />
h) RY Tau<br />
4 h 27 m 57. s 7 57. s 6 57. s 5 57. s 4 57. s 3 57. s 2 57. s 1<br />
j) GM Aur<br />
4h55 m11. s3 10. s 11. 9<br />
s2 11. s1 11. s0 10. s8 10. s7 10. s6 RA (J2000)<br />
Anteil zu ermitteln, wurden fünf Objekte zusätzlich bei<br />
größeren Wellenlängen von 1.3, 2.0 <strong>und</strong> 3.6 cm beobachtet,<br />
bei vier von ihnen ließ sich die Bremsstrahlung<br />
nachweisen. Hieraus ließ sich ableiten, dass diese zur<br />
Millimeter-Emission im Mittel etwa 60 % beiträgt. Die-<br />
ser Anteil wurde bei der anschließenden Analyse <strong>und</strong><br />
Interpretation der Daten berücksichtigt.<br />
Zunächst einmal kann man angesichts der Größe der<br />
Scheiben davon ausgehen, dass die Emission bei 7 mm<br />
überwiegend optisch dünn ist. Lediglich ein geringer<br />
Anteil aus dem optisch dichten, inneren Bereich der<br />
Scheibe kommt hinzu. Aus der gemessenen Emission bei<br />
7 mm <strong>und</strong> anderen Beobachtungen im Millimeterbereich<br />
wurde die spektrale Energieverteilung der zirkumstellaren<br />
Scheiben bestimmt. Aus ihrem Verlauf ließ sich der<br />
so genannte Opazitätsindex ermitteln (Abb. II.1.3). Er<br />
ist ein Maß <strong>für</strong> die Größe der Teilchen. Für interstellare<br />
Teilchen mit Größen im Submikrometerbereich besitzt<br />
er etwa den Wert 2, bei sehr großen Körpern, die fast<br />
das gesamte Licht absorbieren, sinkt er auf null ab.