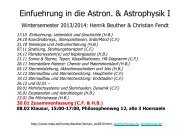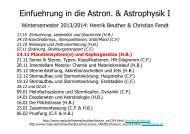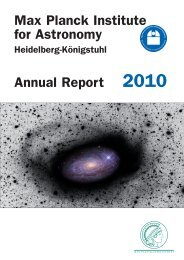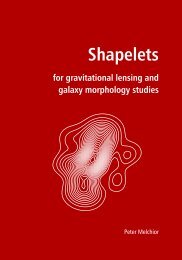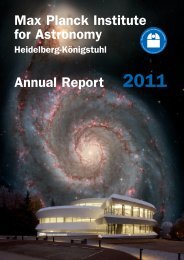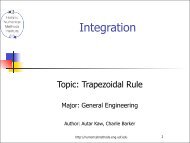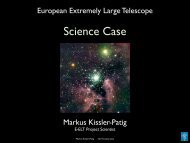V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
60 III. Wissenschaftliche Arbeiten<br />
Verteilungen zwingt. Charakteristisch hierbei ist die<br />
Ansammlung von einwärts driftenden Staubpartikeln an<br />
Resonanzstellen entlang der Umlaufbahn des Planeten.<br />
Auch hat die gravitative Streuung des Staubes an den<br />
Planeten zur Folge, dass in äußeren Planetesimalgürteln<br />
erzeugter Staub nicht oder nur in beschränktem Maße<br />
Bereiche innerhalb der Umlaufbahn eines Planeten erreichen<br />
kann. Wie staubarm das von der Planetenbahn<br />
eingeschlossene innere Gebiet eines Planetensystems<br />
wird, ist konsequenterweise wesentlich von der Masse<br />
des Planeten abhängig (Abb. III.2.7).<br />
Können die Auswirkungen von Planeten in Debris-<br />
Scheiben beobachtet werden? Ja, denn die beschriebenen<br />
Effekte verändern die Staubverteilung in Debris-<br />
Scheiben in so großen Bereichen, dass sie bereits mit<br />
heutigen Beobachtungsinstrumenten räumlich aufgelöst<br />
<strong>und</strong> damit nachgewiesen werden können. Wiederum sind<br />
es im fernen Infrarot- bis Millimeterwellenlängenbereich<br />
gewonnene Bilder, welche die charakteristischen<br />
Resonanzstrukturen oder staubarmen inneren Bereiche in<br />
Debris-Scheiben am besten sichtbar machen. Dies liegt<br />
an der geringen Temperatur des Staubes in den Außenbereichen<br />
der Scheibe, dessen thermische Reemission<br />
wir bei diesen Wellenlängen beobachten.<br />
In Ergänzung hierzu ist es auch möglich, aus Spektren<br />
von Debris-Scheiben, die im nahen bis mittleren Infrarot<br />
gewonnen werden, auf staubarme Bereiche um den Stern<br />
zu schließen: Je näher am Stern sich Staub befindet, desto<br />
wärmer ist er. Fehlt ausgerechnet dieser sternnahe Staub,<br />
so spiegelt sich dies in einem verringerten Fluss in eben<br />
diesem Wellenlängenbereich wider.<br />
Numerische Simulationen von Debris-Scheiben können<br />
helfen, Bilder von Debris-Scheiben genauer zu analysieren.<br />
Statt der einfachen Aussage, dass der Einfluss<br />
eines Planeten <strong>für</strong> die beobachtete Struktur einer Debris-<br />
Scheibe verantwortlich sein muss, lässt der Vergleich mit<br />
Simulationen Rückschlüsse auf Masse <strong>und</strong> genaue Um-<br />
laufbahn des Planeten, sowie auf den beobachteten Staub<br />
– den Entstehungsort <strong>und</strong> seine typische Größe – zu.<br />
Zusammenfassung <strong>und</strong> Ausblick<br />
Numerische Simulationen zeigen, dass Teleskope <strong>und</strong><br />
Beobachtungsinstrumente, wie sie uns in wenigen Jahren<br />
zur Verfügung stehen werden, den Nachweis von Planeten<br />
in zirkumstellaren Scheiben erlauben werden. Allerdings<br />
wird es die Streuung des Sternlichts and die Wärmestrahlung<br />
der kleinsten Staubpartikel schwierig machen, Planeten<br />
direkt abzubilden. Aber Planeten prägen den zirkumstellaren<br />
Scheiben großskalige, charakteristische Signaturen<br />
auf, welche mit Observatorien wie dem Atacama Large<br />
Millimeter Array (ALMA), dem Stratospheric Observatory<br />
For Infrared Astronomy (SOFIA) <strong>und</strong> dem James Webb Space<br />
Telescope (JWST) in wenigen Jahren beobachtbar sein<br />
werden. Primäre Signaturen sind Lücken in jungen Schei-<br />
ben <strong>und</strong> asymmetrische Dichtemuster in Debris-Scheiben.<br />
Abb. III.2.7: Simulierte Debris-Scheibe des jungen Sonnensystems<br />
bei einer Wellenlänge von 1.3 mm. Die Position des<br />
Neptun ist markiert. Man sieht die hufeisenförmige Verteilung<br />
von Staubpartikeln entlang der Umlaufbahn von Neptun.<br />
Außerdem ist zu erkennen, dass Neptun den Innenbereich<br />
seiner Bahn sehr effektiv von den im außerhalb seiner Bahn gelegenen<br />
Kuipergürtel durch Planetesimalkollisionen erzeugten<br />
Staubkörnern frei hält. (S. Wolf <strong>und</strong> A. Morio-Martin)<br />
All diese zukünftigen Beobachtungen werden uns hel-<br />
fen, ein klareres Bild von der Planetenentstehung zu<br />
entwerfen, indem es uns gelingen wird, die vielen freien<br />
Parameter in unseren numerischen Modellen einzuschränken.<br />
Somit hoffen wir der großen Frage nach dem<br />
Ursprung unseres Heimatplaneten <strong>und</strong> nach der Häufigkeit<br />
erdähnlicher Planeten bei fernen Sonnen ein wenig<br />
näher zu kommen.<br />
(Theoriegruppe der Abt. Planeten- <strong>und</strong><br />
Sternentstehung am MPIA:<br />
Hubert Klahr (PI), Anders Johansen,<br />
Markus Feldt, Thomas Henning,<br />
Natalia Dzyurkevich; Willhelm Kley/Tübingen,<br />
Peter Bodenheimer / Lick Observatory, Santa Cruz;<br />
Emmy-Noether-Forschungsgruppe »Evolution of circumstellar<br />
dust disks to planetary systems« am MPIA:<br />
Sebastian Wolf (PI), Jens Rodmann, Kacper Kornet,<br />
Alexander Schegerer; Gennaro D`Angelo/Exeter,<br />
Amaya Moro-Martin/Princeton, Karl R. Stapelfeldt/<br />
JPL,Deborah L. Padgett/CIT)