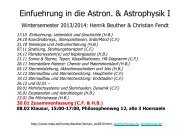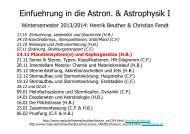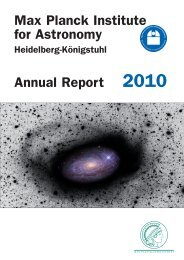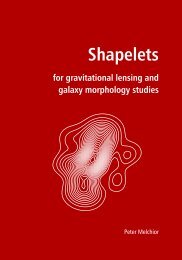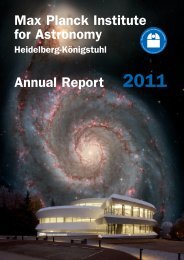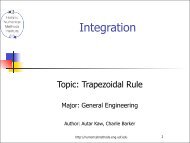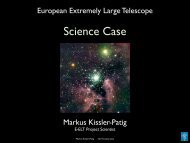V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
dieser Problematik hat Alan Boss von der Carnegie <strong>Institut</strong>ion<br />
in Washington Mitte der neunziger Jahre das Kant-<br />
Laplace-Modell in seiner Urform wieder in die Diskussion<br />
eingebracht. Demnach entstehen Planeten, wenn in<br />
der Scheibe einzelne Bereiche instabil werden <strong>und</strong> sich<br />
aufgr<strong>und</strong> der Schwerkraft verdichten. Ein fester Planetenkern<br />
könnte entstehen, wenn Staub in das Zentrum<br />
eines sich verdichtenden Gasklumpens absinkt. Auf diese<br />
Weise könnte sich ein Gasplanet innerhalb weniger<br />
tausend Jahre bilden – zumindest theoretisch. Unklar ist<br />
allerdings, ob die hier<strong>für</strong> notwendigen Bedingungen in<br />
einer protoplanetaren Scheibe überhaupt auftreten können.<br />
Diese muss nämlich wesentlich massereicher <strong>und</strong><br />
dichter sein als es bisherige Beobachtungen nahe legen.<br />
Außerdem sind diese lokalen Gasverdichtungen zunächst<br />
sehr instabil <strong>und</strong> können in der rotierenden Scheibe leicht<br />
zerrissen werden.<br />
Hubert Klahr vom MPIA hat jüngst ein Modell entwickelt,<br />
das eine Art Brücke zwischen den beiden konkur-<br />
rierenden Modellen schlägt. Demnach könnten in einer<br />
Scheibe »magnetische Wirbelstürme« entstehen, entfernt<br />
mit Hochdrucksystemen in der Erdatmosphäre vergleich-<br />
bar. Staub würde in diese Wirbel hineinströmen <strong>und</strong> sich<br />
darin ansammeln. Auf diese Weise könnten die »protoplanetaren<br />
Hurricanes« als Verstärker der Planetenentstehung<br />
funktionieren (siehe Kap. III.2).<br />
Die Vorgänge in einer protoplanetaren Scheibe sind<br />
so vielfältig <strong>und</strong> spielen sich auf einer so weiten Größen-<br />
skala ab, dass sie sich mit Simulationen allein bei wei-<br />
tem nicht vollständig beschreiben lassen. Astronomische<br />
Beobachtungen <strong>und</strong> seit jüngerer Zeit auch Laborexperimente<br />
müssen Fakten liefern, um die Vielfalt der theoretisch<br />
denkbaren Szenarien einzuschränken. Auf diesem<br />
Gebiet haben die Wissenschaftler erhebliche Fortschritte<br />
gemacht.<br />
Wie Thomas Henning <strong>und</strong> Kees Dullemond berichteten,<br />
lassen sich aus der beobachteten Energieverteilung<br />
im Infraroten sehr viele Details der protoplanetaren<br />
Scheibe ableiten. So ist es beispielsweise möglich, die<br />
Ausdehnung der Scheibe zu ermitteln oder Lücken, die<br />
ein großer Planet in die Scheibe gerissen haben könnte,<br />
nachzuweisen. Mit Hilfe von Infrarotspektren, wie sie<br />
seit kurzem das Weltraumteleskop SPITZER liefert, ist es<br />
auch möglich, die Signaturen von Wasser-, Kohlenmonoxid-<br />
<strong>und</strong> Kohlendioxid-Eis nachzuweisen, die auf Silikatteilchen<br />
ausgefroren sind.<br />
Neben Computersimulationen <strong>und</strong> Teleskopbeobachtungen<br />
spielen zunehmend auch Laborexperimente ei-<br />
ne Rolle, in denen die Entwicklung von Staubteilchen in<br />
protoplanetaren Scheiben nachgestellt wird. Jürgen Blum<br />
von der TU Braunschweig untersucht auf diese Weise<br />
die Frage, unter welchen Umständen kleine Staubteilchen<br />
sich zusammenlagern <strong>und</strong> zu größeren Aggregaten an-<br />
wachsen können, <strong>und</strong> welche Eigenschaften diese Aggregate<br />
haben. Experimente in der Schwerelosigkeit, an<br />
Bord eines Space Shuttle <strong>und</strong> als Nutzlast in einer ballistischen<br />
Rakete, brachten hier jüngst große Fortschritte.<br />
V.6 Ringebrg.Workshop »Vom Staubkorn zum Planeten« 117<br />
Abb. V.6.4: Starker Schneefall hatte Schloss Ringberg ein malerisches<br />
Flair verliehen.<br />
So ließ sich verfolgen, wie winzige Partikel bei langsamen<br />
Stößen aneinander haften bleiben <strong>und</strong> langsam zu<br />
größeren Partikeln anwachsen.<br />
Trotz großer Fortschritte im Verständnis der Planetenentstehung<br />
brennen die Astronomen natürlich darauf, ex-<br />
trasolare Planeten direkt zu beobachten. Wolfgang<br />
Brandner berichtete, dass man vom Erdboden aus mit In-<br />
terferometern, zum Beispiel am Very Large Telescope<br />
der Europäischen Südsternwarte, ESO, oder am Keck-<br />
Observatorium auf Hawaii, innerhalb der nächsten Jahre<br />
einige junge, helle Planeten der Jupiterklasse aufspüren<br />
könnte. Allerdings bewegen sich die Astronomen bei<br />
dieser Aufgabe am Rande des Möglichen. Die besten<br />
Chancen wird wohl erst der Nachfolger von HUBBLE, das<br />
James-Webb-Weltraumteleskop (JWST), bieten. Dessen<br />
Start ist <strong>für</strong> Mitte 2011 geplant. Mit ihm sollte es möglich<br />
sein, Gasriesen im Infraroten direkt zu beobachten.<br />
Sowohl am VLTI als auch am JWST sind Astronomen<br />
des MPIA beteiligt.<br />
Das Studium protoplanetarer Scheiben wird indes<br />
schon früher in eine neue Phase treten, <strong>und</strong> zwar mit dem<br />
Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Dieses von<br />
der ESO <strong>und</strong> den Vereinigten Staaten gebaute Array entsteht<br />
derzeit auf dem 5000 Meter hohen Berg Chajnantor<br />
in den chilenischen Anden. Erste Messungen sollen 2007<br />
beginnen, das gesamte Array mit 64 Radioteleskopen<br />
wird 2012 in Betrieb gehen.<br />
(Hubert Klahr, Wolfgang Brandner)