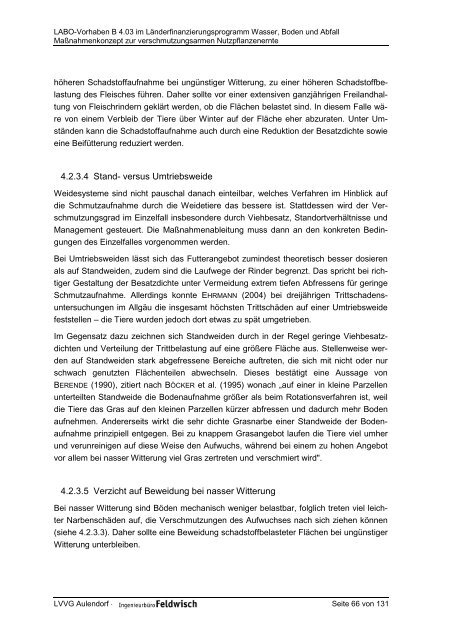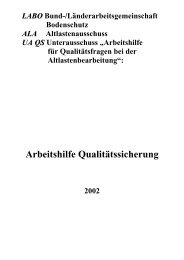Maßnahmenkonzept zur verschmutzungsarmen Nutzpflanzenernte
Maßnahmenkonzept zur verschmutzungsarmen Nutzpflanzenernte
Maßnahmenkonzept zur verschmutzungsarmen Nutzpflanzenernte
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
LABO-Vorhaben B 4.03 im Länderfinanzierungsprogramm Wasser, Boden und Abfall<br />
<strong>Maßnahmenkonzept</strong> <strong>zur</strong> <strong>verschmutzungsarmen</strong> <strong>Nutzpflanzenernte</strong><br />
höheren Schadstoffaufnahme bei ungünstiger Witterung, zu einer höheren Schadstoffbelastung<br />
des Fleisches führen. Daher sollte vor einer extensiven ganzjährigen Freilandhaltung<br />
von Fleischrindern geklärt werden, ob die Flächen belastet sind. In diesem Falle wäre<br />
von einem Verbleib der Tiere über Winter auf der Fläche eher ab<strong>zur</strong>aten. Unter Umständen<br />
kann die Schadstoffaufnahme auch durch eine Reduktion der Besatzdichte sowie<br />
eine Beifütterung reduziert werden.<br />
4.2.3.4 Stand- versus Umtriebsweide<br />
Weidesysteme sind nicht pauschal danach einteilbar, welches Verfahren im Hinblick auf<br />
die Schmutzaufnahme durch die Weidetiere das bessere ist. Stattdessen wird der Verschmutzungsgrad<br />
im Einzelfall insbesondere durch Viehbesatz, Standortverhältnisse und<br />
Management gesteuert. Die Maßnahmenableitung muss dann an den konkreten Bedingungen<br />
des Einzelfalles vorgenommen werden.<br />
Bei Umtriebsweiden lässt sich das Futterangebot zumindest theoretisch besser dosieren<br />
als auf Standweiden, zudem sind die Laufwege der Rinder begrenzt. Das spricht bei richtiger<br />
Gestaltung der Besatzdichte unter Vermeidung extrem tiefen Abfressens für geringe<br />
Schmutzaufnahme. Allerdings konnte EHRMANN (2004) bei dreijährigen Trittschadensuntersuchungen<br />
im Allgäu die insgesamt höchsten Trittschäden auf einer Umtriebsweide<br />
feststellen – die Tiere wurden jedoch dort etwas zu spät umgetrieben.<br />
Im Gegensatz dazu zeichnen sich Standweiden durch in der Regel geringe Viehbesatzdichten<br />
und Verteilung der Trittbelastung auf eine größere Fläche aus. Stellenweise werden<br />
auf Standweiden stark abgefressene Bereiche auftreten, die sich mit nicht oder nur<br />
schwach genutzten Flächenteilen abwechseln. Dieses bestätigt eine Aussage von<br />
BERENDE (1990), zitiert nach BÖCKER et al. (1995) wonach „auf einer in kleine Parzellen<br />
unterteilten Standweide die Bodenaufnahme größer als beim Rotationsverfahren ist, weil<br />
die Tiere das Gras auf den kleinen Parzellen kürzer abfressen und dadurch mehr Boden<br />
aufnehmen. Andererseits wirkt die sehr dichte Grasnarbe einer Standweide der Bodenaufnahme<br />
prinzipiell entgegen. Bei zu knappem Grasangebot laufen die Tiere viel umher<br />
und verunreinigen auf diese Weise den Aufwuchs, während bei einem zu hohen Angebot<br />
vor allem bei nasser Witterung viel Gras zertreten und verschmiert wird".<br />
4.2.3.5 Verzicht auf Beweidung bei nasser Witterung<br />
Bei nasser Witterung sind Böden mechanisch weniger belastbar, folglich treten viel leichter<br />
Narbenschäden auf, die Verschmutzungen des Aufwuchses nach sich ziehen können<br />
(siehe 4.2.3.3). Daher sollte eine Beweidung schadstoffbelasteter Flächen bei ungünstiger<br />
Witterung unterbleiben.<br />
LVVG Aulendorf ⋅ Seite 66 von 131