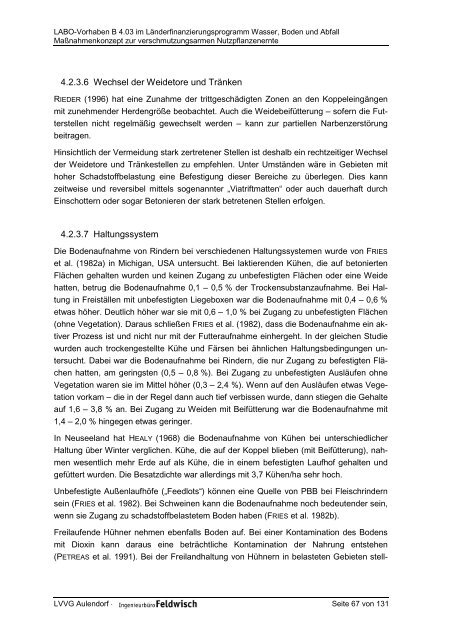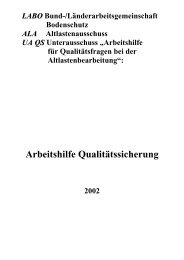Maßnahmenkonzept zur verschmutzungsarmen Nutzpflanzenernte
Maßnahmenkonzept zur verschmutzungsarmen Nutzpflanzenernte
Maßnahmenkonzept zur verschmutzungsarmen Nutzpflanzenernte
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
LABO-Vorhaben B 4.03 im Länderfinanzierungsprogramm Wasser, Boden und Abfall<br />
<strong>Maßnahmenkonzept</strong> <strong>zur</strong> <strong>verschmutzungsarmen</strong> <strong>Nutzpflanzenernte</strong><br />
4.2.3.6 Wechsel der Weidetore und Tränken<br />
RIEDER (1996) hat eine Zunahme der trittgeschädigten Zonen an den Koppeleingängen<br />
mit zunehmender Herdengröße beobachtet. Auch die Weidebeifütterung – sofern die Futterstellen<br />
nicht regelmäßig gewechselt werden – kann <strong>zur</strong> partiellen Narbenzerstörung<br />
beitragen.<br />
Hinsichtlich der Vermeidung stark zertretener Stellen ist deshalb ein rechtzeitiger Wechsel<br />
der Weidetore und Tränkestellen zu empfehlen. Unter Umständen wäre in Gebieten mit<br />
hoher Schadstoffbelastung eine Befestigung dieser Bereiche zu überlegen. Dies kann<br />
zeitweise und reversibel mittels sogenannter „Viatriftmatten“ oder auch dauerhaft durch<br />
Einschottern oder sogar Betonieren der stark betretenen Stellen erfolgen.<br />
4.2.3.7 Haltungssystem<br />
Die Bodenaufnahme von Rindern bei verschiedenen Haltungssystemen wurde von FRIES<br />
et al. (1982a) in Michigan, USA untersucht. Bei laktierenden Kühen, die auf betonierten<br />
Flächen gehalten wurden und keinen Zugang zu unbefestigten Flächen oder eine Weide<br />
hatten, betrug die Bodenaufnahme 0,1 – 0,5 % der Trockensubstanzaufnahme. Bei Haltung<br />
in Freiställen mit unbefestigten Liegeboxen war die Bodenaufnahme mit 0,4 – 0,6 %<br />
etwas höher. Deutlich höher war sie mit 0,6 – 1,0 % bei Zugang zu unbefestigten Flächen<br />
(ohne Vegetation). Daraus schließen FRIES et al. (1982), dass die Bodenaufnahme ein aktiver<br />
Prozess ist und nicht nur mit der Futteraufnahme einhergeht. In der gleichen Studie<br />
wurden auch trockengestellte Kühe und Färsen bei ähnlichen Haltungsbedingungen untersucht.<br />
Dabei war die Bodenaufnahme bei Rindern, die nur Zugang zu befestigten Flächen<br />
hatten, am geringsten (0,5 – 0,8 %). Bei Zugang zu unbefestigten Ausläufen ohne<br />
Vegetation waren sie im Mittel höher (0,3 – 2,4 %). Wenn auf den Ausläufen etwas Vegetation<br />
vorkam – die in der Regel dann auch tief verbissen wurde, dann stiegen die Gehalte<br />
auf 1,6 – 3,8 % an. Bei Zugang zu Weiden mit Beifütterung war die Bodenaufnahme mit<br />
1,4 – 2,0 % hingegen etwas geringer.<br />
In Neuseeland hat HEALY (1968) die Bodenaufnahme von Kühen bei unterschiedlicher<br />
Haltung über Winter verglichen. Kühe, die auf der Koppel blieben (mit Beifütterung), nahmen<br />
wesentlich mehr Erde auf als Kühe, die in einem befestigten Laufhof gehalten und<br />
gefüttert wurden. Die Besatzdichte war allerdings mit 3,7 Kühen/ha sehr hoch.<br />
Unbefestigte Außenlaufhöfe („Feedlots“) können eine Quelle von PBB bei Fleischrindern<br />
sein (FRIES et al. 1982). Bei Schweinen kann die Bodenaufnahme noch bedeutender sein,<br />
wenn sie Zugang zu schadstoffbelastetem Boden haben (FRIES et al. 1982b).<br />
Freilaufende Hühner nehmen ebenfalls Boden auf. Bei einer Kontamination des Bodens<br />
mit Dioxin kann daraus eine beträchtliche Kontamination der Nahrung entstehen<br />
(PETREAS et al. 1991). Bei der Freilandhaltung von Hühnern in belasteten Gebieten stell-<br />
LVVG Aulendorf ⋅ Seite 67 von 131