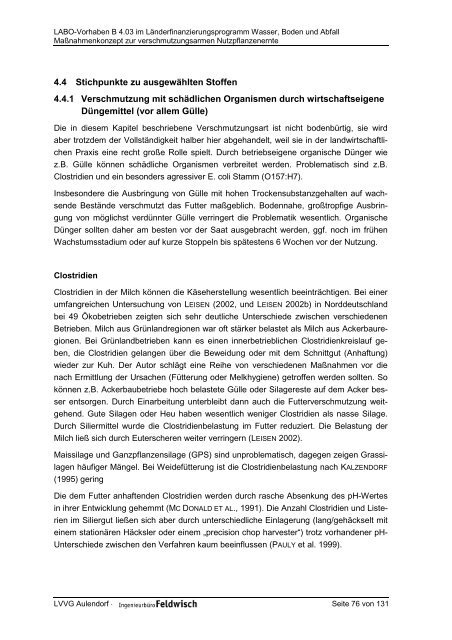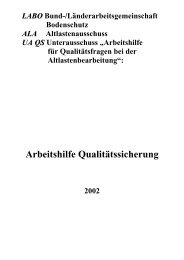Maßnahmenkonzept zur verschmutzungsarmen Nutzpflanzenernte
Maßnahmenkonzept zur verschmutzungsarmen Nutzpflanzenernte
Maßnahmenkonzept zur verschmutzungsarmen Nutzpflanzenernte
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
LABO-Vorhaben B 4.03 im Länderfinanzierungsprogramm Wasser, Boden und Abfall<br />
<strong>Maßnahmenkonzept</strong> <strong>zur</strong> <strong>verschmutzungsarmen</strong> <strong>Nutzpflanzenernte</strong><br />
4.4 Stichpunkte zu ausgewählten Stoffen<br />
4.4.1 Verschmutzung mit schädlichen Organismen durch wirtschaftseigene<br />
Düngemittel (vor allem Gülle)<br />
Die in diesem Kapitel beschriebene Verschmutzungsart ist nicht bodenbürtig, sie wird<br />
aber trotzdem der Vollständigkeit halber hier abgehandelt, weil sie in der landwirtschaftlichen<br />
Praxis eine recht große Rolle spielt. Durch betriebseigene organische Dünger wie<br />
z.B. Gülle können schädliche Organismen verbreitet werden. Problematisch sind z.B.<br />
Clostridien und ein besonders agressiver E. coli Stamm (O157:H7).<br />
Insbesondere die Ausbringung von Gülle mit hohen Trockensubstanzgehalten auf wachsende<br />
Bestände verschmutzt das Futter maßgeblich. Bodennahe, großtropfige Ausbringung<br />
von möglichst verdünnter Gülle verringert die Problematik wesentlich. Organische<br />
Dünger sollten daher am besten vor der Saat ausgebracht werden, ggf. noch im frühen<br />
Wachstumsstadium oder auf kurze Stoppeln bis spätestens 6 Wochen vor der Nutzung.<br />
Clostridien<br />
Clostridien in der Milch können die Käseherstellung wesentlich beeinträchtigen. Bei einer<br />
umfangreichen Untersuchung von LEISEN (2002, und LEISEN 2002b) in Norddeutschland<br />
bei 49 Ökobetrieben zeigten sich sehr deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen<br />
Betrieben. Milch aus Grünlandregionen war oft stärker belastet als Milch aus Ackerbauregionen.<br />
Bei Grünlandbetrieben kann es einen innerbetrieblichen Clostridienkreislauf geben,<br />
die Clostridien gelangen über die Beweidung oder mit dem Schnittgut (Anhaftung)<br />
wieder <strong>zur</strong> Kuh. Der Autor schlägt eine Reihe von verschiedenen Maßnahmen vor die<br />
nach Ermittlung der Ursachen (Fütterung oder Melkhygiene) getroffen werden sollten. So<br />
können z.B. Ackerbaubetriebe hoch belastete Gülle oder Silagereste auf dem Acker besser<br />
entsorgen. Durch Einarbeitung unterbleibt dann auch die Futterverschmutzung weitgehend.<br />
Gute Silagen oder Heu haben wesentlich weniger Clostridien als nasse Silage.<br />
Durch Siliermittel wurde die Clostridienbelastung im Futter reduziert. Die Belastung der<br />
Milch ließ sich durch Euterscheren weiter verringern (LEISEN 2002).<br />
Maissilage und Ganzpflanzensilage (GPS) sind unproblematisch, dagegen zeigen Grassilagen<br />
häufiger Mängel. Bei Weidefütterung ist die Clostridienbelastung nach KALZENDORF<br />
(1995) gering<br />
Die dem Futter anhaftenden Clostridien werden durch rasche Absenkung des pH-Wertes<br />
in ihrer Entwicklung gehemmt (MC DONALD ET AL., 1991). Die Anzahl Clostridien und Listerien<br />
im Siliergut ließen sich aber durch unterschiedliche Einlagerung (lang/gehäckselt mit<br />
einem stationären Häcksler oder einem „precision chop harvester“) trotz vorhandener pH-<br />
Unterschiede zwischen den Verfahren kaum beeinflussen (PAULY et al. 1999).<br />
LVVG Aulendorf ⋅ Seite 76 von 131