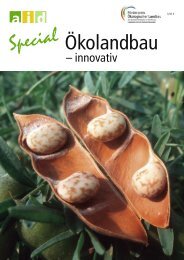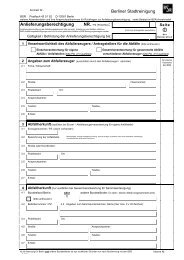Migration und Gesundheit - BITV-Test
Migration und Gesundheit - BITV-Test
Migration und Gesundheit - BITV-Test
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ges<strong>und</strong>heitsversorgung für Menschen mit <strong>Migration</strong>shintergr<strong>und</strong> <strong>Migration</strong> <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit 109<br />
Diese Werteentscheidung im Ausländerrecht<br />
ist auf die nachrangige Versicherungspflicht in<br />
der gesetzlichen Krankenversicherung übertragen<br />
worden. Der Gesetzgeber will damit verhindern,<br />
dass diese Gruppe von Ausländerinnen <strong>und</strong> Ausländer<br />
versicherungspflichtig in der gesetzlichen<br />
Krankenversicherung wird <strong>und</strong> damit im Krankheitsfall<br />
die Solidargemeinschaft der gesetzlich<br />
Krankenversicherten in Anspruch nimmt.<br />
Die Voraussetzung, dass die Ausländerin bzw.<br />
der Ausländer entweder eine Niederlassungserlaubnis<br />
oder eine auf mehr als zwölf Monate befristete<br />
Aufenthaltserlaubnis besitzen muss, soll<br />
den gesetzlichen Krankenkassen die ansonsten<br />
notwendige Prüfung ersparen, ob die/der Betreffende<br />
ihren/seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen<br />
Aufenthalt in Deutschland hat.<br />
Ferner wurde mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz<br />
die Vorschrift des § 315 des Fünften<br />
Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) eingefügt.<br />
Sie regelt, dass Personen ohne Absicherung im<br />
Krankheitsfall, die früher privat versichert waren<br />
oder die bisher weder gesetzlich noch privat<br />
krankenversichert waren <strong>und</strong> dem System der<br />
privaten Krankenversicherung zuzuordnen sind,<br />
ab 01.07.2007 einen Krankenversicherungsschutz<br />
im Standardtarif eines privaten Krankenversicherungsunternehmens<br />
verlangen können. Diese<br />
Vorschrift ist aber nur für Personen anwendbar,<br />
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt<br />
im Geltungsbereich des SGB V haben (§ 30 Abs. 1<br />
SGB I, § 3 Nr. 2 SGB IV). Für Ausländerinnen <strong>und</strong><br />
Ausländer, die ihren Wohnsitz bzw. gewöhnlichen<br />
Aufenthalt nicht in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland<br />
haben, trifft dies nicht zu.<br />
In analoger Anwendung des § 5 Abs. 11 SGB V<br />
muss bei der Auslegung des Begriffs »Wohnsitz<br />
oder gewöhnlicher Aufenthalt« bei Ausländerinnen<br />
<strong>und</strong> Ausländern, die nicht Angehörige eines<br />
Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines<br />
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen<br />
Wirtschaftsraum oder Staatsangehörige<br />
der Schweiz sind, eine Niederlassungserlaubnis<br />
oder eine Aufenthaltserlaubnis von mehr als zwölf<br />
Monaten vorliegen.<br />
6.1.2 Kommunikationsprobleme<br />
Kommunikationsprobleme entstehen zum einen<br />
durch unzureichende bzw. lückenhafte Deutschkenntnisse<br />
mancher Menschen mit <strong>Migration</strong>shintergr<strong>und</strong><br />
in den Bereichen Körper, Ges<strong>und</strong>heit,<br />
Befinden <strong>und</strong> Sexualität. Zum anderen sind<br />
Hinweise <strong>und</strong> Informationen zu Ges<strong>und</strong>heitsleistungen<br />
häufig nicht in einer für diesen Personenkreis<br />
verständlichen Sprache oder Form verfasst.<br />
Eine Studie unter türkischen <strong>und</strong> deutschen<br />
Krankenhauspatientinnen zeigte, dass gerade<br />
die türkischen Patientinnen die Informationen<br />
zu Diagnose <strong>und</strong> Therapie, welche ihnen in den<br />
Aufklärungsgesprächen von den Stationsärztinnen<br />
<strong>und</strong> -ärzten gegeben wurden, vielfach nicht<br />
verstanden hatten. Es konnte sogar ein Informationsverlust<br />
festgestellt werden: Vor dem Aufklärungsgespräch<br />
gaben 62 % der 262 türkischen<br />
Patientinnen die Diagnose <strong>und</strong> 71 % die Therapie<br />
richtig an. Nach der Patientenaufklärung konnten<br />
nur noch 55 % die Diagnose <strong>und</strong> 66 % die Therapie<br />
korrekt wiedergeben. Ein solcher Effekt wurde<br />
bei den deutschen Patientinnen (n = 317) nicht<br />
festgestellt. Sowohl ein niedriger Bildungsgrad als<br />
auch keine oder geringe Deutschkenntnisse der<br />
türkischsprachigen Patientinnen waren mit geringerem<br />
Wissen um die Diagnose <strong>und</strong> die Therapie<br />
assoziiert. Das Ziel, eine geeignete Aufklärung der<br />
Patientin bzw. des Patienten vor einer Therapie<br />
oder einem chirurgischen Eingriff durchzuführen,<br />
wurde nicht erreicht [5]. Dies schränkt die<br />
Selbstbestimmungs- <strong>und</strong> Mitbestimmungsmöglichkeiten<br />
der Patientinnen <strong>und</strong> Patienten ein, die<br />
wiederum mit dem Patientenrecht auf Information<br />
<strong>und</strong> Aufklärung verb<strong>und</strong>en sind [6].<br />
Die Übermittlung von Ges<strong>und</strong>heitsinformationen<br />
erfordert Kompetenz, nicht nur auf<br />
sprachlicher Ebene. So müssen z. B. kulturspezifische<br />
Kommunikationswege, Tabus, aber auch<br />
der jeweilige Wissens- bzw. Bildungsstand der<br />
Zielgruppe Berücksichtigung finden. Eine vergleichende<br />
Untersuchung an türkischen (n = 262)<br />
<strong>und</strong> deutschen (n = 320) Frauen ergab, dass 62 %<br />
der türkischen Frauen über ein geringes Ges<strong>und</strong>heitswissen<br />
über den eigenen Körper <strong>und</strong> dessen<br />
Funktionen verfügten. Im Gegensatz dazu wiesen<br />
nur 15 % der deutschen Patientinnen einen vergleichbar<br />
geringen Kenntnisstand auf [7]. Visuelle<br />
Kommunikationshilfen oder auch Dolmetscher-