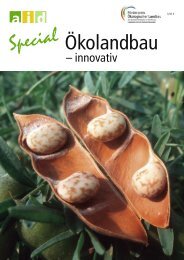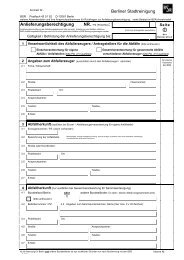Migration und Gesundheit - BITV-Test
Migration und Gesundheit - BITV-Test
Migration und Gesundheit - BITV-Test
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
56 <strong>Migration</strong> <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit Ges<strong>und</strong>heitliche Lage <strong>und</strong> migrationsspezifische Belastungen<br />
eine nach Nichtdeutschen <strong>und</strong> Deutschen differenzierende<br />
Sonderauswertung eignen sich die<br />
Angaben zu Nichraucherinnen/Nichtrauchern, gegenwärtig<br />
regelmäßigen Raucherinnen/Rauchern<br />
(siehe Tabelle 3.3.2.1) <strong>und</strong> dem Durchschnittsalter<br />
bei Rauchbeginn. Andere Variablen weisen große<br />
Daten lücken auf.<br />
Bei den Männern findet sich in den Jahren<br />
2003 <strong>und</strong> 2005 ein höherer Anteil von Rauchern<br />
unter den Nichtdeutschen als unter den Deutschen<br />
(plus 9 % bis 10 %). Der Unterschied zur Berufsschulstudie<br />
von Dill [69] liegt dabei vermutlich in<br />
den unterschiedlichen Altersgruppen begründet.<br />
Der Anteil der regelmäßigen Raucherinnen liegt<br />
unter den nichtdeutschen Frauen in den Altersgruppen<br />
unter 65 Jahren stets niedriger als unter<br />
den deutschen Frauen. Nichtdeutsche Frauen weisen<br />
nur deshalb einen insgesamt höheren Anteil<br />
regelmäßiger Raucherinnen auf, weil in dieser<br />
Gruppe anteilig mehr junge Frauen befragt wurden<br />
als bei den deutschen Frauen. Im Vergleich<br />
der Daten zur Rauchprävalenz im Mikrozensus<br />
1999 (Daten nicht gezeigt) ist in der Altersgruppe<br />
der 40- bis 64-jährigen deutschen Frauen eine<br />
Zunahme der regelmäßigen Raucherinnen bzw.<br />
Raucher zu beobachten, ansonsten scheinen in<br />
allen Gruppen die regelmäßigen Raucherinnen<br />
bzw. Raucher abzunehmen.<br />
Eine Sonderauswertung der Mikrozensusdaten<br />
zum Rauchverhalten nach Schulabschlüssen<br />
<strong>und</strong> Altersgruppen ist möglich, allerdings<br />
lässt sich diese zusätzliche Auswertung wegen zu<br />
geringer Fallzahlen nicht geschlechtsspezifisch<br />
durchführen. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e wird auf eine<br />
detaillierte Darstellung verzichtet. In der Tendenz<br />
bestätigen die Mikrozensusdaten die Beobachtung,<br />
dass mit steigendem Bildungsgrad der Anteil<br />
der Raucherinnen bzw. Raucher abnimmt [70].<br />
Diese Beobachtung gilt sowohl für deutsche als<br />
auch für nichtdeutsche Staatsangehörige. Da sich<br />
Tabakkonsummuster auch zwischen Migrantengruppen<br />
verschiedener Herkunft erheblich unterscheiden<br />
können, wäre die Ergänzung zukünftiger<br />
Erhebungen in Deutschland um entsprechend<br />
differenzierte Daten sinnvoll.<br />
Wertet man die Daten des Mikrozensus 2005<br />
nach <strong>Migration</strong>shintergr<strong>und</strong> (statt wie oben nach<br />
Staatsangehörigkeit) aus, so zeigt sich analog zu<br />
Tabelle 3.3.2.1 sowohl bei Männern als auch bei<br />
Frauen ein Rückgang des Tabakkonsums mit zu-<br />
nehmendem Alter [42]. Anders als beim Vergleich<br />
»deutsch« vs. »nichtdeutsch« zählen Frauen mit<br />
<strong>Migration</strong>shintergr<strong>und</strong> aber häufiger zu den<br />
Nichtraucherinnen als Frauen ohne <strong>Migration</strong>shintergr<strong>und</strong><br />
(79,2 vs. 77,3 %) [42]. Dieser Unterschied<br />
zur Auswertung nach Staatsangehörigkeit<br />
kann nicht allein durch eine unterschiedliche<br />
Altersverteilung erklärt werden, sondern spiegelt<br />
wirkliche Unterschiede wider.<br />
Medikamentenabhängigkeit<br />
Zur Frage der Verbreitung von Medikamentennutzung<br />
<strong>und</strong> -abhängigkeit bei Menschen mit <strong>Migration</strong>shintergr<strong>und</strong><br />
stehen derzeit keine aussagekräftigen<br />
Informationen zur Verfügung. Es wird<br />
geschätzt, dass in Deutschland ca. 1,4 Millionen<br />
Personen medikamentabhängig sind [71]. Versuche,<br />
aus dem ausländischen Bevölkerungsanteil<br />
auf die vermutliche Zahl von betroffenen ausländischen<br />
Staatsangehörigen zu schließen, sind wissenschaftlich<br />
kaum haltbar. Hier sind zunächst<br />
weitere Studien erforderlich.<br />
Alkoholkonsum<br />
Alkohol ist ein gesellschaftlich weitgehend akzeptiertes<br />
Suchtmittel. Dies steht im Kontrast zu<br />
den ausgeprägten ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>und</strong> sozialen<br />
Folgen eines ständigen oder exzessiven Konsums.<br />
Stärker als der Tabakkonsum wird der Alkoholkonsum<br />
auch von religiösen Vorschriften erfasst.<br />
So finden sich beim Alkoholkonsum je nach Religionszugehörigkeit<br />
erhebliche Unterschiede bei<br />
Jugendlichen. Gemäß der allerdings nicht repräsentativen<br />
Studie von Dill konsumieren nur 37 %<br />
der islamischen Jugendlichen gegenüber 62 %<br />
der Jugendlichen mit anderer Religionszugehörigkeit<br />
Alkohol [69]. Mit zunehmender Aufenthaltsdauer<br />
in Deutschland nimmt die Häufigkeit<br />
des Alkoholkonsums zu. Menschen mit <strong>Migration</strong>shintergr<strong>und</strong>,<br />
die in Deutschland geboren <strong>und</strong><br />
aufgewachsen sind, trinken häufiger alkoholische<br />
Getränke als Jugendliche, die erst nach 1990 nach<br />
Deutschland gezogen sind. Es scheint, dass eine<br />
hohe soziale Integration in die Peergroup (Gruppe<br />
von Gleichaltrigen) den Alkoholkonsum von<br />
türkischen Jugendlichen begünstigt, während bei<br />
deutschen Jugendlichen eher ein psychosomatischer<br />
Beschwerdedruck den Alkoholkonsum fördert<br />
[72]. Weder der durchschnittlich niedrigere<br />
Konsum noch seine absehbare Angleichung an