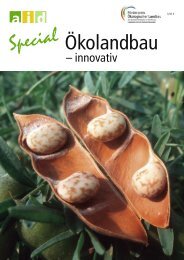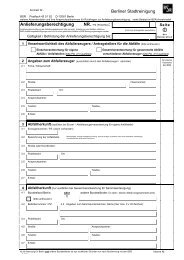Migration und Gesundheit - BITV-Test
Migration und Gesundheit - BITV-Test
Migration und Gesundheit - BITV-Test
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ges<strong>und</strong>heitliche Lage <strong>und</strong> migrationsspezifische Belastungen <strong>Migration</strong> <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit 57<br />
das höhere inländische Niveau lässt Rückschlüsse<br />
auf das Potenzial für Suchterkrankungen zu.<br />
Spezifischere Hinweise auf das Risiko von<br />
alkoholbedingten Suchterkrankungen kann man<br />
aus Diagnosen der stationären Rehabilitation<br />
gewinnen. Eine Auswertung von Daten zur Teilnahme<br />
an der Rehabilitation für das Jahr 2000 in<br />
Nordrhein-Westfalen zeigt, dass bei den Männern<br />
ausländische Staatsangehörige im Vergleich zu<br />
Deutschen seltener wegen Alkoholfolgen (ICD-10:<br />
F10), aber häufiger wegen Erkrankungen in Folge<br />
des Gebrauchs psychotroper Substanzen (ICD-10:<br />
F11–19) an einer Rehabilitationsmaßnahme teilnehmen<br />
(bei Berücksichtigung der unterschiedlichen<br />
Altersstruktur). Psychotrope Substanzen,<br />
z. B. Kokain, wirken auf das Nervensystem <strong>und</strong><br />
beeinflussen dadurch psychische Prozesse. Bei<br />
den Frauen werden ausländische Staatsangehörige<br />
seltener wegen Suchterkrankungen behandelt<br />
als Deutsche [73]. Eine Auswertung der Diagnoseverteilungen<br />
in einem psychiatrischen Landeskrankenhaus<br />
im Zeitraum 1990 bis 1996 (7.222<br />
deutsche <strong>und</strong> 287 (Spät-)Aussiedler-Patientinnen<br />
<strong>und</strong> -Patienten) zeigt für beide Gruppen gleiche<br />
Behandlungsanteile für Psychosen (ICD 9: 295,<br />
296, 303) <strong>und</strong> Alkoholabhängigkeit. Deutlich<br />
mehr (Spät-)Aussiedlerinnen <strong>und</strong> (Spät-)Aussiedler<br />
werden wegen Medikamenten- bzw. Drogenabhängigkeit<br />
behandelt (ICD 9: 303). Dabei ist<br />
besonders auffällig, dass die Drogenabhängigkeit<br />
vorwiegend junge Menschen betrifft, die erst nach<br />
der Übersiedlung nach Deutschland mit Drogen<br />
in Kontakt kommen <strong>und</strong> abhängig werden. Sie bilden<br />
auch in sozialer Hinsicht eine Problemgruppe:<br />
Die Hälfte dieser Patientinnen <strong>und</strong> Patienten<br />
hat keine abgeschlossene Berufsausbildung <strong>und</strong><br />
40 % sind erwerbslos [74].<br />
Konsum illegaler Drogen<br />
Zu den illegalen Drogen gehören in Deutschland<br />
neben Heroin, Kokain <strong>und</strong> den Amphetaminen<br />
auch Cannabis <strong>und</strong> Marihuana <strong>und</strong> die so genannten<br />
»Partydrogen« wie Ecstasy. Suchtpotenzial <strong>und</strong><br />
ges<strong>und</strong>heitliche Folgeschäden unterscheiden sich<br />
erheblich zwischen den verschiedenen Typen illegaler<br />
Drogen [75]. Die Untersuchung von Dill et<br />
al. [69] bei Münchener Berufsschülerinnen <strong>und</strong><br />
-schülern gibt Hinweise auf Unterschiede im Konsum<br />
zwischen Deutschen <strong>und</strong> Menschen mit <strong>Migration</strong>shintergr<strong>und</strong>.<br />
Deutsche Berufsschülerinnen<br />
<strong>und</strong> -schüler geben demnach häufiger an, illegale<br />
Drogen konsumiert zu haben als Berufsschülerinnen<br />
<strong>und</strong> -schüler mit <strong>Migration</strong>shintergr<strong>und</strong>. Bei<br />
Letzteren ist der größte Teil der regelmäßigen Konsumenten<br />
illegaler Drogen in Deutschland geboren<br />
<strong>und</strong> aufgewachsen (vgl. Tabelle 3.3.2.2). Im Unterschied<br />
zu deutschen Jugendlichen mit regelmäßigem<br />
Drogenkonsum leben solche mit <strong>Migration</strong>shintergr<strong>und</strong><br />
häufiger im Elternhaus <strong>und</strong> haben mit<br />
den Eltern keine auffällig schlechten Beziehungen.<br />
Dill et al. [69] interpretieren den Drogenkonsum<br />
deshalb auch eher als Ausdruck eines kulturellen<br />
Konflikts: Die Jugendlichen leben in jugendspezifischen<br />
Subkulturen <strong>und</strong> entfernen sich dadurch von<br />
ihrer Herkunftskultur, ohne dass ein konflikthaftes<br />
Verhältnis zu den Eltern als Motiv wirkt. Diese vor<br />
allem den kulturellen Konflikt betonende Interpretation<br />
wird allerdings dadurch in Frage gestellt,<br />
dass für die Therapieprognose auch andere soziale<br />
Faktoren eine zentrale Rolle spielen. So erweist sich<br />
z. B. eine intakte Familienstruktur als günstig; ungünstig<br />
hingegen ist der Zusammenhang mit der<br />
sozialen Desintegration, insbesondere einer fehlenden<br />
Ausbildung <strong>und</strong> Arbeitslosigkeit [76].<br />
Weitere Aussagen zum Konsum illegaler Drogen<br />
lassen sich aus der Kriminalitätsstatistik ableiten.<br />
Die Aussagekraft von Kriminalstatistiken für<br />
Tabelle 3.3.2.2<br />
Drogenerfahrung Münchner Berufsschüler im Alter 15 bis 24 Jahren nach Geschlecht<br />
<strong>und</strong> <strong>Migration</strong>shintergr<strong>und</strong> (2.199 Männer, 3.415 Frauen)<br />
Anteil mit <strong>Migration</strong>shintergr<strong>und</strong> insgesamt = 38,9 %<br />
Quelle: Dill et al. 2002 [69]<br />
Erfahrungen mit illegalen Drogen<br />
regelmäßiger Konsum illegaler Drogen<br />
Frauen Männer Frauen Männer<br />
Deutsche 37,5 % 43,2 % 11,2 % 20,3 %<br />
Migrantinnen/Migranten 18,8 % 24,1 % 5,2 % 15,5 %