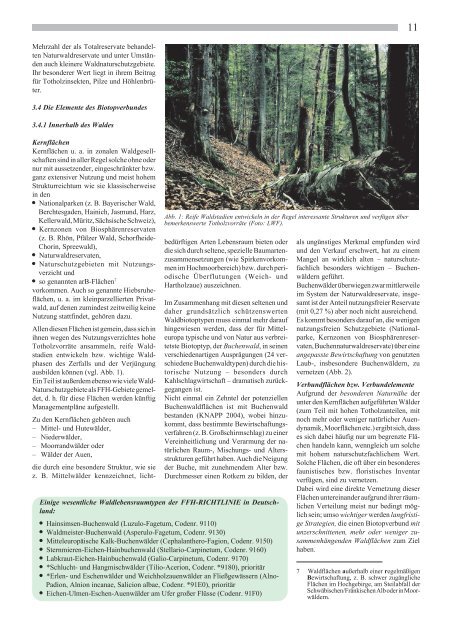Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...
Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...
Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Mehrzahl <strong>der</strong> als Totalreservate behandelten<br />
Naturwaldreservate und unter Umständen<br />
auch kleinere Waldnaturschutzgebiete.<br />
Ihr beson<strong>der</strong>er Wert liegt in ihrem <strong>Beitrag</strong><br />
<strong>für</strong> Totholzinsekten, Pilze und Höhlenbrüter.<br />
3.4 Die Elemente des Biotopverbundes<br />
3.4.1 Innerhalb des Waldes<br />
Kernflächen<br />
Kernflächen u. a. in zonalen Waldgesellschaften<br />
sind in aller Regel solche ohne o<strong>der</strong><br />
nur mit aussetzen<strong>der</strong>, eingeschränkter bzw.<br />
ganz extensiver Nutzung und meist hohem<br />
Strukturreichtum wie sie klassischerweise<br />
in den<br />
Nationalparken (z. B. Bayerischer Wald,<br />
Berchtesgaden, Hainich, Jasmund, Harz,<br />
Kellerwald, Müritz, Sächsische Schweiz),<br />
Kernzonen von Biosphärenreservaten<br />
(z. B. Rhön, Pfälzer Wald, Schorfheide-<br />
Chorin, Spreewald),<br />
Naturwaldreservaten,<br />
Naturschutzgebieten mit Nutzungsverzicht<br />
und<br />
so genannten arB-Flächen7 vorkommen. Auch so genannte Hiebsruheflächen,<br />
u. a. im kleinparzellierten Privatwald,<br />
auf denen <strong>zum</strong>indest zeitweilig keine<br />
Nutzung stattfindet, gehören dazu.<br />
Allen diesen Flächen ist gemein, dass sich in<br />
ihnen wegen des Nutzungsverzichtes hohe<br />
Totholzvorräte ansammeln, reife Waldstadien<br />
entwickeln bzw. wichtige Waldphasen<br />
des Zerfalls und <strong>der</strong> Verjüngung<br />
ausbilden können (vgl. Abb. 1).<br />
Ein Teil ist außerdem ebenso wie viele Wald-<br />
Naturschutzgebiete als FFH-Gebiete gemeldet,<br />
d. h. <strong>für</strong> diese Flächen werden künftig<br />
Managementpläne aufgestellt.<br />
Zu den Kernflächen gehören auch<br />
– Mittel- und Hutewäl<strong>der</strong>,<br />
– Nie<strong>der</strong>wäl<strong>der</strong>,<br />
– Moorrandwäl<strong>der</strong> o<strong>der</strong><br />
– Wäl<strong>der</strong> <strong>der</strong> Auen,<br />
die durch eine beson<strong>der</strong>e Struktur, wie sie<br />
z. B. Mittelwäl<strong>der</strong> kennzeichnet, licht-<br />
bedürftigen Arten Lebensraum bieten o<strong>der</strong><br />
die sich durch seltene, spezielle Baumartenzusammensetzungen<br />
(wie Spirkenvorkommen<br />
im Hochmoorbereich) bzw. durch periodische<br />
Überflutungen (Weich- und<br />
Hartholzaue) auszeichnen.<br />
Im Zusammenhang mit diesen seltenen und<br />
daher grundsätzlich schützenswerten<br />
Waldbiotoptypen muss einmal mehr darauf<br />
hingewiesen werden, dass <strong>der</strong> <strong>für</strong> Mitteleuropa<br />
typische und von Natur aus verbreitetste<br />
Biotoptyp, <strong>der</strong> Buchenwald, in seinen<br />
verschiedenartigen Ausprägungen (24 verschiedene<br />
Buchenwaldtypen) durch die historische<br />
Nutzung – beson<strong>der</strong>s durch<br />
Kahlschlagwirtschaft – dramatisch zurückgegangen<br />
ist.<br />
Nicht einmal ein Zehntel <strong>der</strong> potenziellen<br />
Buchenwaldflächen ist mit Buchenwald<br />
bestanden (KNAPP 2004), wobei hinzukommt,<br />
dass bestimmte Bewirtschaftungsverfahren<br />
(z. B. Großschirmschlag) zu einer<br />
Vereinheitlichung und Verarmung <strong>der</strong> natürlichen<br />
Raum-, Mischungs- und Altersstrukturen<br />
geführt haben. Auch die Neigung<br />
<strong>der</strong> Buche, mit zunehmendem Alter bzw.<br />
Durchmesser einen Rotkern zu bilden, <strong>der</strong><br />
Einige wesentliche Waldlebensraumtypen <strong>der</strong> FFH-RICHTLINIE in Deutschland:<br />
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum, Codenr. 9110)<br />
Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum, Codenr. 9130)<br />
Mitteleuropäische Kalk-Buchenwäl<strong>der</strong> (Cephalanthero-Fagion, Codenr. 9150)<br />
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum, Codenr. 9160)<br />
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum, Codenr. 9170)<br />
*Schlucht- und Hangmischwäl<strong>der</strong> (Tilio-Acerion, Codenr. *9180), prioritär<br />
*Erlen- und Eschenwäl<strong>der</strong> und Weichholzauenwäl<strong>der</strong> an Fließgewässern (Alno-<br />
Padion, Alnion incanae, Salicion albae, Codenr. *91E0), prioritär<br />
Eichen-Ulmen-Eschen-Auenwäl<strong>der</strong> am Ufer großer Flüsse (Codenr. 91F0)<br />
Abb. 1: Reife Waldstadien entwickeln in <strong>der</strong> Regel interessante Strukturen und verfügen über<br />
bemerkenswerte Totholzvorräte (Foto: LWF).<br />
11<br />
als ungünstiges Merkmal empfunden wird<br />
und den Verkauf erschwert, hat zu einem<br />
Mangel an wirklich alten – naturschutzfachlich<br />
beson<strong>der</strong>s wichtigen – Buchenwäl<strong>der</strong>n<br />
geführt.<br />
Buchenwäl<strong>der</strong> überwiegen zwar mittlerweile<br />
im System <strong>der</strong> Naturwaldreservate, insgesamt<br />
ist <strong>der</strong> Anteil nutzungsfreier Reservate<br />
(mit 0,27 %) aber noch nicht ausreichend.<br />
Es kommt beson<strong>der</strong>s darauf an, die wenigen<br />
nutzungsfreien Schutzgebiete (Nationalparke,<br />
Kernzonen von Biosphärenreservaten,<br />
Buchennaturwaldreservate) über eine<br />
angepasste Bewirtschaftung von genutzten<br />
Laub-, insbeson<strong>der</strong>e Buchenwäl<strong>der</strong>n, zu<br />
vernetzen (Abb. 2).<br />
Verbundflächen bzw. Verbundelemente<br />
Aufgrund <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>en Naturnähe <strong>der</strong><br />
unter den Kernflächen aufgeführten Wäl<strong>der</strong><br />
(<strong>zum</strong> Teil mit hohen Totholzanteilen, mit<br />
noch mehr o<strong>der</strong> weniger natürlicher Auendynamik,<br />
Moorflächen etc.) ergibt sich, dass<br />
es sich dabei häufig nur um begrenzte Flächen<br />
handeln kann, wenngleich um solche<br />
mit hohem naturschutzfachlichem Wert.<br />
Solche Flächen, die oft über ein beson<strong>der</strong>es<br />
faunistisches bzw. floristisches Inventar<br />
verfügen, sind zu vernetzen.<br />
Dabei wird eine direkte Vernetzung dieser<br />
Flächen untereinan<strong>der</strong> aufgrund ihrer räumlichen<br />
Verteilung meist nur bedingt möglich<br />
sein; umso wichtiger werden langfristige<br />
Strategien, die einen Biotopverbund mit<br />
unzerschnittenen, mehr o<strong>der</strong> weniger zusammenhängenden<br />
Waldflächen <strong>zum</strong> Ziel<br />
haben.<br />
7 Waldflächen außerhalb einer regelmäßigen<br />
Bewirtschaftung, z. B. schwer zugängliche<br />
Flächen im Hochgebirge, am Steilabfall <strong>der</strong><br />
Schwäbischen/Fränkischen Alb o<strong>der</strong> in Moorwäl<strong>der</strong>n.