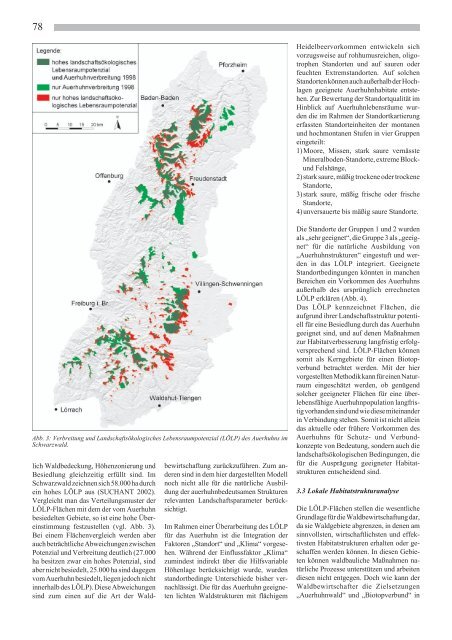Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...
Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...
Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
78<br />
Abb. 3: Verbreitung und Landschaftsökologisches Lebensraumpotenzial (LÖLP) des Auerhuhns im<br />
Schwarzwald.<br />
lich Waldbedeckung, Höhenzonierung und<br />
Besiedlung gleichzeitig erfüllt sind. Im<br />
Schwarzwald zeichnen sich 58.000 ha durch<br />
ein hohes LÖLP aus (SUCHANT 2002).<br />
Vergleicht man das Verteilungsmuster <strong>der</strong><br />
LÖLP-Flächen mit dem <strong>der</strong> vom Auerhuhn<br />
besiedelten Gebiete, so ist eine hohe Übereinstimmung<br />
festzustellen (vgl. Abb. 3).<br />
Bei einem Flächenvergleich werden aber<br />
auch beträchtliche Abweichungen zwischen<br />
Potenzial und Verbreitung deutlich (27.000<br />
ha besitzen zwar ein hohes Potenzial, sind<br />
aber nicht besiedelt, 25.000 ha sind dagegen<br />
vom Auerhuhn besiedelt, liegen jedoch nicht<br />
innerhalb des LÖLP). Diese Abweichungen<br />
sind <strong>zum</strong> einen auf die Art <strong>der</strong> Wald-<br />
bewirtschaftung zurückzuführen. Zum an<strong>der</strong>en<br />
sind in dem hier dargestellten Modell<br />
noch nicht alle <strong>für</strong> die natürliche Ausbildung<br />
<strong>der</strong> auerhuhnbedeutsamen Strukturen<br />
relevanten Landschaftsparameter berücksichtigt.<br />
Im Rahmen einer Überarbeitung des LÖLP<br />
<strong>für</strong> das Auerhuhn ist die Integration <strong>der</strong><br />
Faktoren „Standort“ und „Klima“ vorgesehen.<br />
Während <strong>der</strong> Einflussfaktor „Klima“<br />
<strong>zum</strong>indest indirekt über die Hilfsvariable<br />
Höhenlage berücksichtigt wurde, wurden<br />
standortbedingte Unterschiede bisher vernachlässigt.<br />
Die <strong>für</strong> das Auerhuhn geeigneten<br />
lichten Waldstrukturen mit flächigem<br />
Heidelbeervorkommen entwickeln sich<br />
vorzugsweise auf rohhumusreichen, oligotrophen<br />
Standorten und auf sauren o<strong>der</strong><br />
feuchten Extremstandorten. Auf solchen<br />
Standorten können auch außerhalb <strong>der</strong> Hochlagen<br />
geeignete Auerhuhnhabitate entstehen.<br />
Zur Bewertung <strong>der</strong> Standortqualität im<br />
Hinblick auf Auerhuhnlebensräume wurden<br />
die im Rahmen <strong>der</strong> Standortkartierung<br />
erfassten Standorteinheiten <strong>der</strong> montanen<br />
und hochmontanen Stufen in vier Gruppen<br />
eingeteilt:<br />
1)Moore, Missen, stark saure vernässte<br />
Mineralboden-Standorte, extreme Blockund<br />
Felshänge,<br />
2)stark saure, mäßig trockene o<strong>der</strong> trockene<br />
Standorte,<br />
3)stark saure, mäßig frische o<strong>der</strong> frische<br />
Standorte,<br />
4)unversauerte bis mäßig saure Standorte.<br />
Die Standorte <strong>der</strong> Gruppen 1 und 2 wurden<br />
als „sehr geeignet“, die Gruppe 3 als „geeignet“<br />
<strong>für</strong> die natürliche Ausbildung von<br />
„Auerhuhnstrukturen“ eingestuft und werden<br />
in das LÖLP integriert. Geeignete<br />
Standortbedingungen könnten in manchen<br />
Bereichen ein Vorkommen des Auerhuhns<br />
außerhalb des ursprünglich errechneten<br />
LÖLP erklären (Abb. 4).<br />
Das LÖLP kennzeichnet Flächen, die<br />
aufgrund ihrer Landschaftsstruktur potentiell<br />
<strong>für</strong> eine Besiedlung durch das Auerhuhn<br />
geeignet sind, und auf denen Maßnahmen<br />
zur Habitatverbesserung langfristig erfolgversprechend<br />
sind. LÖLP-Flächen können<br />
somit als Kerngebiete <strong>für</strong> einen Biotopverbund<br />
betrachtet werden. Mit <strong>der</strong> hier<br />
vorgestellten Methodik kann <strong>für</strong> einen Naturraum<br />
eingeschätzt werden, ob genügend<br />
solcher geeigneter Flächen <strong>für</strong> eine überlebensfähige<br />
Auerhuhnpopulation langfristig<br />
vorhanden sind und wie diese miteinan<strong>der</strong><br />
in Verbindung stehen. Somit ist nicht allein<br />
das aktuelle o<strong>der</strong> frühere Vorkommen des<br />
Auerhuhns <strong>für</strong> Schutz- und Verbundkonzepte<br />
von Bedeutung, son<strong>der</strong>n auch die<br />
landschaftsökologischen Bedingungen, die<br />
<strong>für</strong> die Ausprägung geeigneter Habitatstrukturen<br />
entscheidend sind.<br />
3.3 Lokale Habitatstrukturanalyse<br />
Die LÖLP-Flächen stellen die wesentliche<br />
Grundlage <strong>für</strong> die Waldbewirtschaftung dar,<br />
da sie Waldgebiete abgrenzen, in denen am<br />
sinnvollsten, wirtschaftlichsten und effektivsten<br />
Habitatstrukturen erhalten o<strong>der</strong> geschaffen<br />
werden können. In diesen Gebieten<br />
können waldbauliche Maßnahmen natürliche<br />
Prozesse unterstützen und arbeiten<br />
diesen nicht entgegen. Doch wie kann <strong>der</strong><br />
Waldbewirtschafter die Zielsetzungen<br />
„Auerhuhnwald“ und „Biotopverbund“ in