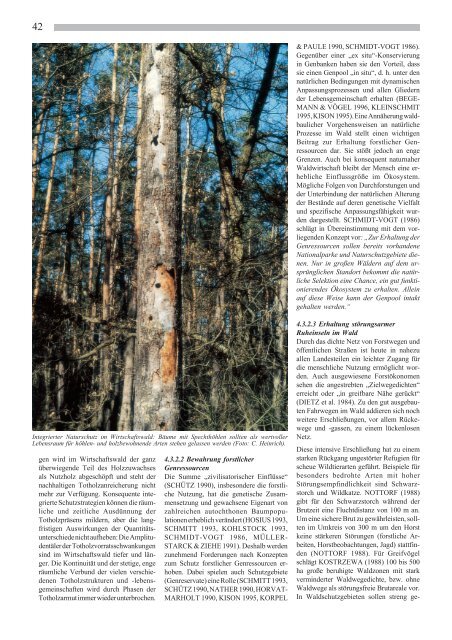Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...
Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...
Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
42<br />
Integrierter Naturschutz im Wirtschaftswald: Bäume mit Spechthöhlen sollten als wertvoller<br />
Lebensraum <strong>für</strong> höhlen- und holzbewohnende Arten stehen gelassen werden (Foto: C. Heinrich).<br />
gen wird im Wirtschaftswald <strong>der</strong> ganz<br />
überwiegende Teil des Holzzuwachses<br />
als Nutzholz abgeschöpft und steht <strong>der</strong><br />
nachhaltigen Totholzanreicherung nicht<br />
mehr zur Verfügung. Konsequente integrierte<br />
Schutzstrategien können die räumliche<br />
und zeitliche Ausdünnung <strong>der</strong><br />
Totholzpräsens mil<strong>der</strong>n, aber die langfristigen<br />
Auswirkungen <strong>der</strong> Quantitätsunterschiede<br />
nicht aufheben: Die Amplitudentäler<br />
<strong>der</strong> Totholzvorratsschwankungen<br />
sind im Wirtschaftswald tiefer und länger.<br />
Die Kontinuität und <strong>der</strong> stetige, enge<br />
räumliche Verbund <strong>der</strong> vielen verschiedenen<br />
Totholzstrukturen und -lebensgemeinschaften<br />
wird durch Phasen <strong>der</strong><br />
Totholzarmut immer wie<strong>der</strong> unterbrochen.<br />
4.3.2.2 Bewahrung forstlicher<br />
Genressourcen<br />
Die Summe „zivilisatorischer Einflüsse“<br />
(SCHÜTZ 1990), insbeson<strong>der</strong>e die forstliche<br />
Nutzung, hat die genetische Zusammensetzung<br />
und gewachsene Eigenart von<br />
zahlreichen autochthonen Baumpopulationen<br />
erheblich verän<strong>der</strong>t (HOSIUS 1993,<br />
SCHMITT 1993, KOHLSTOCK 1993,<br />
SCHMIDT-VOGT 1986, MÜLLER-<br />
STARCK & ZIEHE 1991). Deshalb werden<br />
zunehmend For<strong>der</strong>ungen nach Konzepten<br />
<strong>zum</strong> Schutz forstlicher Genressourcen erhoben.<br />
Dabei spielen auch Schutzgebiete<br />
(Genreservate) eine Rolle (SCHMITT 1993,<br />
SCHÜTZ 1990, NATHER 1990, HORVAT-<br />
MARHOLT 1990, KISON 1995, KORPEL<br />
& PAULE 1990, SCHMIDT-VOGT 1986).<br />
Gegenüber einer „ex situ“-Konservierung<br />
in Genbanken haben sie den Vorteil, dass<br />
sie einen Genpool „in situ“, d. h. unter den<br />
natürlichen Bedingungen mit dynamischen<br />
Anpassungsprozessen und allen Glie<strong>der</strong>n<br />
<strong>der</strong> Lebensgemeinschaft erhalten (BEGE-<br />
MANN & VÖGEL 1996, KLEINSCHMIT<br />
1995, KISON 1995). Eine Annäherung waldbaulicher<br />
Vorgehensweisen an natürliche<br />
Prozesse im Wald stellt einen wichtigen<br />
<strong>Beitrag</strong> zur Erhaltung forstlicher Genressourcen<br />
dar. Sie stößt jedoch an enge<br />
Grenzen. Auch bei konsequent naturnaher<br />
<strong>Waldwirtschaft</strong> bleibt <strong>der</strong> Mensch eine erhebliche<br />
Einflussgröße im Ökosystem.<br />
Mögliche Folgen von Durchforstungen und<br />
<strong>der</strong> Unterbindung <strong>der</strong> natürlichen Alterung<br />
<strong>der</strong> Bestände auf <strong>der</strong>en genetische Vielfalt<br />
und spezifische Anpassungsfähigkeit wurden<br />
dargestellt. SCHMIDT-VOGT (1986)<br />
schlägt in Übereinstimmung mit dem vorliegenden<br />
Konzept vor: „Zur Erhaltung <strong>der</strong><br />
Genressourcen sollen bereits vorhandene<br />
Nationalparke und Naturschutzgebiete dienen.<br />
Nur in großen Wäl<strong>der</strong>n auf dem ursprünglichen<br />
Standort bekommt die natürliche<br />
Selektion eine Chance, ein gut funktionierendes<br />
Ökosystem zu erhalten. Allein<br />
auf diese Weise kann <strong>der</strong> Genpool intakt<br />
gehalten werden.“<br />
4.3.2.3 Erhaltung störungsarmer<br />
Ruheinseln im Wald<br />
Durch das dichte Netz von Forstwegen und<br />
öffentlichen Straßen ist heute in nahezu<br />
allen Landesteilen ein leichter Zugang <strong>für</strong><br />
die menschliche Nutzung ermöglicht worden.<br />
Auch ausgewiesene Forstökonomen<br />
sehen die angestrebten „Zielwegedichten“<br />
erreicht o<strong>der</strong> „in greifbare Nähe gerückt“<br />
(DIETZ et al. 1984). Zu den gut ausgebauten<br />
Fahrwegen im Wald addieren sich noch<br />
weitere Erschließungen, vor allem Rückewege<br />
und -gassen, zu einem lückenlosen<br />
Netz.<br />
Diese intensive Erschließung hat zu einem<br />
starken Rückgang ungestörter Refugien <strong>für</strong><br />
scheue Wildtierarten geführt. Beispiele <strong>für</strong><br />
beson<strong>der</strong>s bedrohte Arten mit hoher<br />
Störungsempfindlichkeit sind Schwarzstorch<br />
und Wildkatze. NOTTORF (1988)<br />
gibt <strong>für</strong> den Schwarzstorch während <strong>der</strong><br />
Brutzeit eine Fluchtdistanz von 100 m an.<br />
Um eine sichere Brut zu gewährleisten, sollten<br />
im Umkreis von 300 m um den Horst<br />
keine stärkeren Störungen (forstliche Arbeiten,<br />
Horstbeobachtungen, Jagd) stattfinden<br />
(NOTTORF 1988). Für Greifvögel<br />
schlägt KOSTRZEWA (1988) 100 bis 500<br />
ha große beruhigte Waldzonen mit stark<br />
vermin<strong>der</strong>ter Waldwegedichte, bzw. ohne<br />
Waldwege als störungsfreie Brutareale vor.<br />
In Waldschutzgebieten sollen streng ge-