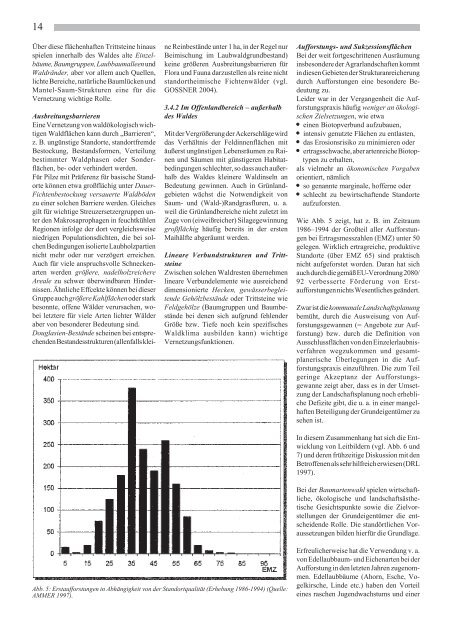Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...
Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...
Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
14<br />
Über diese flächenhaften Trittsteine hinaus<br />
spielen innerhalb des Waldes alte Einzelbäume,<br />
Baumgruppen, Laubbaumalleen und<br />
Waldrän<strong>der</strong>, aber vor allem auch Quellen,<br />
lichte Bereiche, natürliche Baumlücken und<br />
Mantel-Saum-Strukturen eine <strong>für</strong> die<br />
Vernetzung wichtige Rolle.<br />
Ausbreitungsbarrieren<br />
Eine Vernetzung von waldökologisch wichtigen<br />
Waldflächen kann durch „Barrieren“,<br />
z. B. ungünstige Standorte, standortfremde<br />
Bestockung, Bestandsformen, Verteilung<br />
bestimmter Waldphasen o<strong>der</strong> Son<strong>der</strong>flächen,<br />
be- o<strong>der</strong> verhin<strong>der</strong>t werden.<br />
Für Pilze mit Präferenz <strong>für</strong> basische Standorte<br />
können etwa großflächig unter Dauer-<br />
Fichtenbestockung versauerte Waldböden<br />
zu einer solchen Barriere werden. Gleiches<br />
gilt <strong>für</strong> wichtige Streuzersetzergruppen unter<br />
den Makrosaprophagen in feuchtkühlen<br />
Regionen infolge <strong>der</strong> dort vergleichsweise<br />
niedrigen Populationsdichten, die bei solchen<br />
Bedingungen isolierte Laubholzpartien<br />
nicht mehr o<strong>der</strong> nur verzögert erreichen.<br />
Auch <strong>für</strong> viele anspruchsvolle Schneckenarten<br />
werden größere, nadelholzreichere<br />
Areale zu schwer überwindbaren Hin<strong>der</strong>nissen.<br />
Ähnliche Effcekte können bei dieser<br />
Gruppe auch größere Kahlflächen o<strong>der</strong> stark<br />
besonnte, offene Wäl<strong>der</strong> verursachen, wobei<br />
letztere <strong>für</strong> viele Arten lichter Wäl<strong>der</strong><br />
aber von beson<strong>der</strong>er Bedeutung sind.<br />
Douglasien-Bestände scheinen bei entsprechenden<br />
Bestandesstrukturen (allenfalls klei-<br />
ne Reinbestände unter 1 ha, in <strong>der</strong> Regel nur<br />
Beimischung im Laubwaldgrundbestand)<br />
keine größeren Ausbreitungsbarrieren <strong>für</strong><br />
Flora und Fauna darzustellen als reine nicht<br />
standortheimische Fichtenwäl<strong>der</strong> (vgl.<br />
GOSSNER 2004).<br />
3.4.2 Im Offenlandbereich – außerhalb<br />
des Waldes<br />
Mit <strong>der</strong> Vergrößerung <strong>der</strong> Ackerschläge wird<br />
das Verhältnis <strong>der</strong> Feldinnenflächen mit<br />
äußerst ungünstigen Lebensräumen zu Rainen<br />
und Säumen mit günstigeren Habitatbedingungen<br />
schlechter, so dass auch außerhalb<br />
des Waldes kleinere Waldinseln an<br />
Bedeutung gewinnen. Auch in Grünlandgebieten<br />
wächst die Notwendigkeit von<br />
Saum- und (Wald-)Randgrasfluren, u. a.<br />
weil die Grünlandbereiche nicht zuletzt im<br />
Zuge von (eiweißreicher) Silagegewinnung<br />
großflächig häufig bereits in <strong>der</strong> ersten<br />
Maihälfte abgeräumt werden.<br />
Lineare Verbundstrukturen und Trittsteine<br />
Zwischen solchen Waldresten übernehmen<br />
lineare Verbundelemente wie ausreichend<br />
dimensionierte Hecken, gewässerbegleitende<br />
Gehölzbestände o<strong>der</strong> Trittsteine wie<br />
Feldgehölze (Baumgruppen und Baumbestände<br />
bei denen sich aufgrund fehlen<strong>der</strong><br />
Größe bzw. Tiefe noch kein spezifisches<br />
Waldklima ausbilden kann) wichtige<br />
Vernetzungsfunktionen.<br />
Abb. 5: Erstaufforstungen in Abhängigkeit von <strong>der</strong> Standortqualität (Erhebung 1986-1994) (Quelle:<br />
AMMER 1997).<br />
Aufforstungs- und Sukzessionsflächen<br />
Bei <strong>der</strong> weit fortgeschrittenen Ausräumung<br />
insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Agrarlandschaften kommt<br />
in diesen Gebieten <strong>der</strong> Strukturanreicherung<br />
durch Aufforstungen eine beson<strong>der</strong>e Bedeutung<br />
zu.<br />
Lei<strong>der</strong> war in <strong>der</strong> Vergangenheit die Aufforstungspraxis<br />
häufig weniger an ökologischen<br />
Zielsetzungen, wie etwa<br />
einen Biotopverbund aufzubauen,<br />
intensiv genutzte Flächen zu entlasten,<br />
das Erosionsrisiko zu minimieren o<strong>der</strong><br />
ertragsschwache, aber artenreiche Biotoptypen<br />
zu erhalten,<br />
als vielmehr an ökonomischen Vorgaben<br />
orientiert, nämlich<br />
so genannte marginale, hofferne o<strong>der</strong><br />
schlecht zu bewirtschaftende Standorte<br />
aufzuforsten.<br />
Wie Abb. 5 zeigt, hat z. B. im Zeitraum<br />
1986–1994 <strong>der</strong> Großteil aller Aufforstungen<br />
bei Ertragsmesszahlen (EMZ) unter 50<br />
gelegen. Wirklich ertragreiche, produktive<br />
Standorte (über EMZ 65) sind praktisch<br />
nicht aufgeforstet worden. Daran hat sich<br />
auch durch die gemäß EU-Verordnung 2080/<br />
92 verbesserte För<strong>der</strong>ung von Erstaufforstungen<br />
nichts Wesentliches geän<strong>der</strong>t.<br />
Zwar ist die kommunale Landschaftsplanung<br />
bemüht, durch die Ausweisung von Aufforstungsgewannen<br />
(= Angebote zur Aufforstung)<br />
bzw. durch die Definition von<br />
Ausschlussflächen von den Einzelerlaubnisverfahren<br />
wegzukommen und gesamtplanerische<br />
Überlegungen in die Aufforstungspraxis<br />
einzuführen. Die <strong>zum</strong> Teil<br />
geringe Akzeptanz <strong>der</strong> Aufforstungsgewanne<br />
zeigt aber, dass es in <strong>der</strong> Umsetzung<br />
<strong>der</strong> Landschaftsplanung noch erhebliche<br />
Defizite gibt, die u. a. in einer mangelhaften<br />
Beteiligung <strong>der</strong> Grundeigentümer zu<br />
sehen ist.<br />
In diesem Zusammenhang hat sich die Entwicklung<br />
von Leitbil<strong>der</strong>n (vgl. Abb. 6 und<br />
7) und <strong>der</strong>en frühzeitige Diskussion mit den<br />
Betroffenen als sehr hilfreich erwiesen (DRL<br />
1997).<br />
Bei <strong>der</strong> Baumartenwahl spielen wirtschaftliche,<br />
ökologische und landschaftsästhetische<br />
Gesichtspunkte sowie die Zielvorstellungen<br />
<strong>der</strong> Grundeigentümer die entscheidende<br />
Rolle. Die standörtlichen Voraussetzungen<br />
bilden hier<strong>für</strong> die Grundlage.<br />
Erfreulicherweise hat die Verwendung v. a.<br />
von Edellaubbaum- und Eichenarten bei <strong>der</strong><br />
Aufforstung in den letzten Jahren zugenommen.<br />
Edellaubbäume (Ahorn, Esche, Vogelkirsche,<br />
Linde etc.) haben den Vorteil<br />
<strong>eines</strong> raschen Jugendwachstums und einer