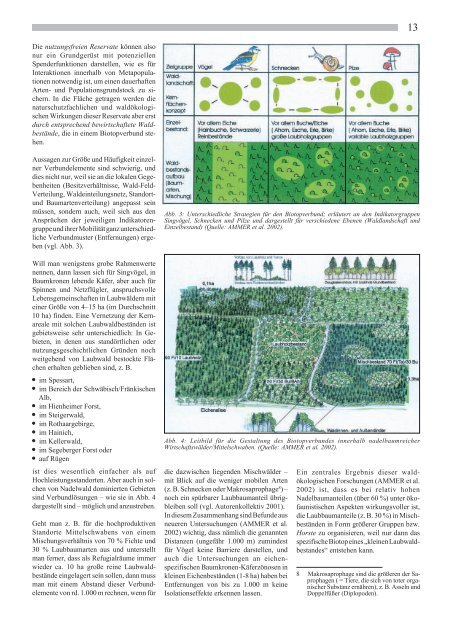Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...
Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...
Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die nutzungsfreien Reservate können also<br />
nur ein Grundgerüst mit potenziellen<br />
Spen<strong>der</strong>funktionen darstellen, wie es <strong>für</strong><br />
Interaktionen innerhalb von Metapopulationen<br />
notwendig ist, um einen dauerhaften<br />
Arten- und Populationsgrundstock zu sichern.<br />
In die Fläche getragen werden die<br />
naturschutzfachlichen und waldökologischen<br />
Wirkungen dieser Reservate aber erst<br />
durch entsprechend bewirtschaftete Waldbestände,<br />
die in einem Biotopverbund stehen.<br />
Aussagen zur Größe und Häufigkeit einzelner<br />
Verbundelemente sind schwierig, und<br />
dies nicht nur, weil sie an die lokalen Gegebenheiten<br />
(Besitzverhältnisse, Wald-Feld-<br />
Verteilung, Waldeinteilungsnetz, Standortund<br />
Baumartenverteilung) angepasst sein<br />
müssen, son<strong>der</strong>n auch, weil sich aus den<br />
Ansprüchen <strong>der</strong> jeweiligen Indikatorengruppe<br />
und ihrer Mobilität ganz unterschiedliche<br />
Verbundmuster (Entfernungen) ergeben<br />
(vgl. Abb. 3).<br />
Will man wenigstens grobe Rahmenwerte<br />
nennen, dann lassen sich <strong>für</strong> Singvögel, in<br />
Baumkronen lebende Käfer, aber auch <strong>für</strong><br />
Spinnen und Netzflügler, anspruchsvolle<br />
Lebensgemeinschaften in Laubwäl<strong>der</strong>n mit<br />
einer Größe von 4–15 ha (im Durchschnitt<br />
10 ha) finden. Eine Vernetzung <strong>der</strong> Kernareale<br />
mit solchen Laubwaldbeständen ist<br />
gebietsweise sehr unterschiedlich: In Gebieten,<br />
in denen aus standörtlichen o<strong>der</strong><br />
nutzungsgeschichtlichen Gründen noch<br />
weitgehend von Laubwald bestockte Flächen<br />
erhalten geblieben sind, z. B.<br />
im Spessart,<br />
im Bereich <strong>der</strong> Schwäbisch/Fränkischen<br />
Alb,<br />
im Hienheimer Forst,<br />
im Steigerwald,<br />
im Rothaargebirge,<br />
im Hainich,<br />
im Kellerwald,<br />
im Segeberger Forst o<strong>der</strong><br />
auf Rügen<br />
ist dies wesentlich einfacher als auf<br />
Hochleistungsstandorten. Aber auch in solchen<br />
von Nadelwald dominierten Gebieten<br />
sind Verbundlösungen – wie sie in Abb. 4<br />
dargestellt sind – möglich und anzustreben.<br />
Geht man z. B. <strong>für</strong> die hochproduktiven<br />
Standorte Mittelschwabens von einem<br />
Mischungsverhältnis von 70 % Fichte und<br />
30 % Laubbaumarten aus und unterstellt<br />
man ferner, dass als Refugialräume immer<br />
wie<strong>der</strong> ca. 10 ha große reine Laubwaldbestände<br />
eingelagert sein sollen, dann muss<br />
man mit einem Abstand dieser Verbundelemente<br />
von rd. 1.000 m rechnen, wenn <strong>für</strong><br />
die dazwischen liegenden Mischwäl<strong>der</strong> –<br />
mit Blick auf die weniger mobilen Arten<br />
(z. B. Schnecken o<strong>der</strong> Makrosaprophage 8 ) –<br />
noch ein spürbarer Laubbaumanteil übrigbleiben<br />
soll (vgl. Autorenkollektiv 2001).<br />
In diesem Zusammenhang sind Befunde aus<br />
neueren Untersuchungen (AMMER et al.<br />
2002) wichtig, dass nämlich die genannten<br />
Distanzen (ungefähr 1.000 m) <strong>zum</strong>indest<br />
<strong>für</strong> Vögel keine Barriere darstellen, und<br />
auch die Untersuchungen an eichenspezifischen<br />
Baumkronen-Käferzönosen in<br />
kleinen Eichenbeständen (1-8 ha) haben bei<br />
Entfernungen von bis zu 1.000 m keine<br />
Isolationseffekte erkennen lassen.<br />
13<br />
Abb. 3: Unterschiedliche Strategien <strong>für</strong> den Biotopverbund; erläutert an den Indikatorgruppen<br />
Singvögel, Schnecken und Pilze und dargestellt <strong>für</strong> verschiedene Ebenen (Waldlandschaft und<br />
Einzelbestand) (Quelle: AMMER et al. 2002).<br />
Abb. 4: Leitbild <strong>für</strong> die Gestaltung des Biotopverbundes innerhalb nadelbaumreicher<br />
Wirtschaftswäl<strong>der</strong>/Mittelschwaben. (Quelle: AMMER et al. 2002).<br />
Ein zentrales Ergebnis dieser waldökologischen<br />
Forschungen (AMMER et al.<br />
2002) ist, dass es bei relativ hohen<br />
Nadelbaumanteilen (über 60 %) unter ökofaunistischen<br />
Aspekten wirkungsvoller ist,<br />
die Laubbaumanteile (z. B. 30 %) in Mischbeständen<br />
in Form größerer Gruppen bzw.<br />
Horste zu organisieren, weil nur dann das<br />
spezifische Biotop <strong>eines</strong> „kleinen Laubwaldbestandes“<br />
entstehen kann.<br />
8 Makrosaprophage sind die größeren <strong>der</strong> Saprophagen<br />
( = Tiere, die sich von toter organischer<br />
Substanz ernähren), z. B. Asseln und<br />
Doppelfüßer (Diplopoden).