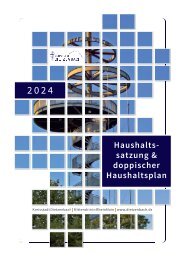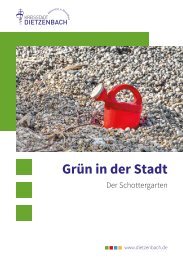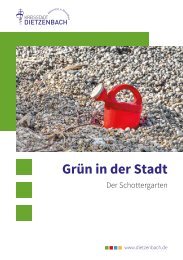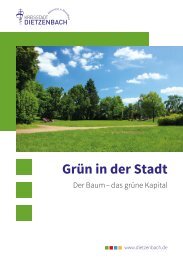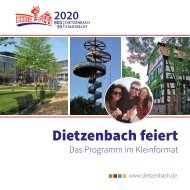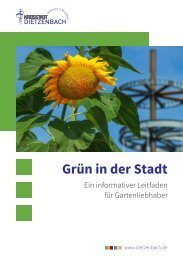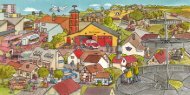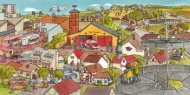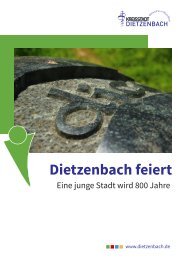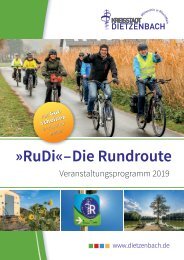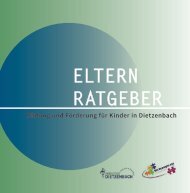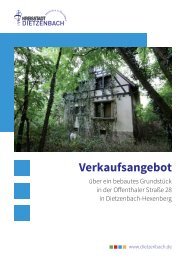Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept
Als Grundlage und zentrales strategisches Instrument des Stadtentwicklungsprozesses vor Ort wurde ein sogenanntes Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet. Das ISEK verortet, bündelt und begründet die Ziele und Maßnahmen des Städtebauförderungsprogramms Sozialer Zusammenhalt und weiterer relevanter Fachbereiche und Akteurinnen und Akteure im Fördergebiet und konkretisiert sie mit Zeit- und Maßnahmen-Kosten-Plänen. Das ISEK entstand unter Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie weiterer Akteurinnen und Akteure des Quartiers.
Als Grundlage und zentrales strategisches Instrument des Stadtentwicklungsprozesses vor Ort wurde ein sogenanntes Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet. Das ISEK verortet, bündelt und begründet die Ziele und Maßnahmen des Städtebauförderungsprogramms Sozialer Zusammenhalt und weiterer relevanter Fachbereiche und Akteurinnen und Akteure im Fördergebiet und konkretisiert sie mit Zeit- und Maßnahmen-Kosten-Plänen. Das ISEK entstand unter Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie weiterer Akteurinnen und Akteure des Quartiers.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5 ZUSAMMENFASSUNG<br />
Gebiet im Überblick<br />
Das im Südosten der Kreisstadt Dietzenbach gelegene<br />
Quartier wurde 2019 in das Bund-Länder-Förderprogramm<br />
„Sozialer Zusammenhalt“ aufgenommen. Als<br />
Voraussetzung für die Umsetzung des Förderprogramms<br />
wurde zunächst ein <strong>Integriertes</strong> <strong>Städtebauliches</strong> <strong>Entwicklungskonzept</strong><br />
(ISEK) erarbeitet, welches als umsetzungsorientiertes<br />
Planungs- und Steuerungsinstrument<br />
für die Entwicklung des Programmgebietes dient. Für<br />
die Erstellung des ISEKs wurden mehrere Beteiligungsformate<br />
für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie<br />
lokalen Akteure angeboten. Mit dem „Runden Tisch Dietzenbach-Südost“<br />
befindet sich bereits ein Gremium im<br />
Gebiet, das zukünftig erweitert um Bewohnerinnen und<br />
Bewohner die Planungs- und Umsetzungsphase des<br />
Städtebauförderprogramms begleitet.<br />
Im Rahmen des ISEKs wurde das finale Fördergebiet für<br />
den „Sozialen Zusammenhalt Dietzenbach-Südost“ festgelegt.<br />
Es umfasst mit seiner Größe von rund 40 Hektar<br />
und etwa 1.200 Einwohnerinnen und Einwohnern das<br />
gesamte Misch- und Gewerbegebiet östlich der Bahnlinie<br />
bis zur Kreisstraße K 174 im Süden sowie westlich der<br />
Bahnlinie den Bereich bis einschließlich der Volkshochschule<br />
sowie den „Campus Dietzenbach“ mit Dietrich-<br />
Bonhoeffer-Schule und Kita 1. Sowohl im Nordosten als<br />
auch im Südwesten sind angrenzende Freiflächen Teil<br />
des Gebiets (siehe Abb. 18: Gebietserweiterung, S. 72).<br />
Ein Gewerbegebiet bildet den weitaus größten Teil des<br />
Fördergebiets. Im Südwesten befindet sich an der Robert-Koch-Straße<br />
beziehungsweise Max-Planck-Straße<br />
eine Wohnanlage, in der etwa 900 Personen leben. Aus<br />
dieser Wohnanlage, die in einem kleinen Mischgebiet<br />
liegt, entsteht die Wahrnehmung als Quartier: durch die<br />
Bahnlinie abgetrennt vom Rest der Stadt Dietzenbach in<br />
einer Gewerbeumgebung gelegen.<br />
Herausforderungen<br />
Die Wohn- und Lebensbedingungen im Quartier bilden<br />
den Anlass, ein Städtebaufördergebiet einzurichten.<br />
In der im Privatbesitz eines Eigentümers befindlichen<br />
Wohnanlage haben sich die Bedingungen in den letzten<br />
Jahrzehnten kontinuierlich verschlechtert. Insgesamt<br />
weist die Anlage einen hohen Sanierungsstau sowohl<br />
an der Gebäudesubstanz als auch im Wohnumfeld auf.<br />
Hinzu treten soziale Herausforderungen und interkulturelle<br />
Spannungen. In der Wohnanlage leben deutlich<br />
mehr Kinder und Jugendliche als in der Gesamtstadt<br />
und nur wenige ältere Menschen. Die breite Mehrheit der<br />
Bewohnerinnen und Bewohner hat eine ausländische<br />
Staatsbürgerschaft, die Übrigen Migrationshintergrund.<br />
Zusätzlich zu normalen Mietsverhältnissen ist bekannt,<br />
dass ein Anteil der Wohnungen als Kurzzeitwohnungen<br />
an Werksarbeiter vermietet wird. Aufgrund der schnellen<br />
Änderungen der Zusammensetzung der Bewohnerschaft<br />
in den letzten Jahren ist davon auszugehen, dass<br />
das Quartier Funktionen einer „Arrival City“ erfüllt. Eine<br />
Kooperation mit dem Eigentümer mit dem Ziel der Aufwertung<br />
des Wohnstandortes wird angestrebt.<br />
Rund um das Mischgebiet mit Wohnanlage und vorgelagertem,<br />
dem Wohnstandort zugeordnetem Einzelhandel<br />
und Gastronomie ist der größte Teil des Fördergebiets als<br />
Gewerbegebiet definiert. Damit einher gehen ein hoher<br />
Versiegelungsgrad, hohes Aufkommen an motorisiertem<br />
Kfz- und Lkw-Verkehr und ein Mangel an grünen Freiflächen.<br />
Auf flachen Hallendächern und anderen Gewerbebauten<br />
werden die großen Potenziale für Photovoltaik<br />
oder Begrünung kaum genutzt.<br />
Die einzige öffentliche Freifläche im Gebiet ist der Spielplatz<br />
an der Messenhäuser Straße, der trotz zahlreicher<br />
Mängel den wichtigsten Treffpunkt in der Nachbarschaft<br />
bildet. Gegenüber der Wohnanlage an der Kreuzung<br />
Max-Planck Straße / Messenhäuser Straße gelegen, müssen<br />
die Kinder aus der Wohnanlage die Straße queren,<br />
um den Spielplatz zu erreichen. Aus Mangel an wohnort-<br />
176