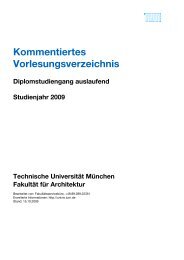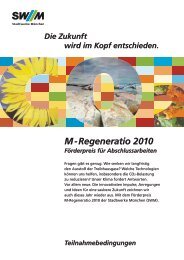Institute Institutes - Fakultät für Architektur - TUM
Institute Institutes - Fakultät für Architektur - TUM
Institute Institutes - Fakultät für Architektur - TUM
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Architektur</strong> ausstellen<br />
Um Fragestellungen der Präsentation von <strong>Architektur</strong> mit eigenen<br />
Erfahrungen zu kommentieren, wird nun auf einige Beispiele<br />
aus der Ausstellungsarbeit des <strong>Architektur</strong>museums der TU<br />
München verwiesen. Die erste <strong>Architektur</strong>ausstellung, die wir<br />
1977 im Münchner Stadtmuseum organisierten, zeigte das Werk<br />
von Friedrich von Thiersch. Es war eine der ersten monografischen<br />
Darstellungen eines Architekten des Historismus, einer<br />
Epoche, die sich damals gerade in einer Neubewertungsphase<br />
befand. Schon bei der Thiersch-Ausstellung ging es darum,<br />
<strong>Architektur</strong>zeichnungen, die nur in seltenen Fällen als eigenständige<br />
grafische Werke konzipiert worden waren, so zu präsentieren,<br />
dass sie nicht wie autonome Kunstwerke rezipiert, sondern<br />
als Teil eines Planungsprozesses verstanden wurden, der durch<br />
Gestaltung des gesamten Ausstellungsraumes deutlich werden<br />
sollte. Da keine Modelle zur Verfügung standen, verwendeten<br />
wir 1977 noch hauptsächlich Objekte aus den Thiersch-Bauten,<br />
um den Charakter historistischer <strong>Architektur</strong> anschaulicher zu<br />
machen. Dokumentation, Didaktik und ästhetische Wirkung der<br />
Objekte standen damals im Vordergrund, <strong>für</strong> die Raumgestaltung<br />
selbst gab es keine Mittel.<br />
Nach etwa zwanzig Ausstellungen in anderen Museen, in denen<br />
wir zu Gast waren, da das <strong>Architektur</strong>museum an der TU München<br />
keine eigenen Ausstellungsräume hatte, sowie weiteren<br />
zwanzig Ausstellungen, an denen mitgewirkt wurde und die<br />
übernommen wurden, konnten im September 2002 erstmals<br />
eigene Räume in der Pinakothek der Moderne bespielt werden.<br />
Wie bei fast allen Ausstellungen seit 1977 haben wir auch in der<br />
Pinakothek der Moderne, in der das <strong>Architektur</strong>museum seit der<br />
Eröffnung 42 Ausstellungen zeigte, weitgehend vermieden,<br />
<strong>Architektur</strong>zeichnungen wie Grafik oder Gemälde als zweidimensionale<br />
Kunstwerke zu präsentieren, es ging immer darum,<br />
architektonische und damit letztlich dreidimensionale Eindrücke<br />
zu vermitteln. Deshalb wurde der Ausstellungsraum selbst immer<br />
mit in die Gestaltung einbezogen, aber nicht im Sinne von Inszenierung,<br />
sondern von Raumgestaltung. <strong>Architektur</strong> im Museum<br />
heißt nach unserem Verständnis, Umsetzung von dreidimensional<br />
konzipierten Objekten in Räume, die so gestaltet werden,<br />
dass die ausgestellten Objekte, die vermittelnde Didaktik und die<br />
Ausstellungsarchitektur sich zu einer Einheit verbinden. Das<br />
bedeutet in letzter Konsequenz, dass <strong>für</strong> jedes Thema und <strong>für</strong><br />
jeden Architekten eine neue Form der Präsentation gefunden<br />
beziehungsweise erarbeitet werden muss. Und genau das haben<br />
wir auch gemacht, denn jede der Ausstellungen zeigt ein eigenes<br />
charakteristisches Gesicht. Dies bringt einen erheblichen Aufwand<br />
bei der Planung mit sich, da jede Ausstellung im Modell<br />
bis ins Detail maßstabsgerecht simuliert und erarbeitet wird, um<br />
die räumliche Gesamtwirkung zu erfassen.<br />
Von besonderer Bedeutung bei dieser Umsetzung ist auch eine<br />
optische und didaktische Dramaturgie im buchstäblichen Sinne,<br />
denn Ausstellungen haben immer auch eine Art Bühnencharakter.<br />
So wie nach dem dramaturgischen Prinzip die Akteure reduziert<br />
und komponierte Spannungsbögen durch mehrere Akte<br />
geschaffen werden, so werden in der Ausstellung Blick- und<br />
Bewegungsrichtungen, optische Akzente, Material-, Farb- oder<br />
Exhibiting Architecture<br />
Let me point out some examples of exhibition work by the<br />
<strong>Architektur</strong>museum der TU München and so comment on problems<br />
in the presentation of architecture as I have experienced<br />
them personally. The first architectural exhibition we organised,<br />
in the Municipal Museum of Munich in 1977, showed the work<br />
of Friedrich von Thiersch. It was one of our first monographic<br />
presentations of an architect of historicism, an epoch being newly<br />
evaluated at that time. The Thiersch exhibition was already<br />
about presenting architectural drawings, which had only rarely<br />
been conceived as independent graphic works, in such a way that<br />
they were not received like autonomous works of art, but understood<br />
as part of a planning process. The intention was to make<br />
this clear through the design of the whole exhibition space. As<br />
there were no models available, in 1977 we still used mainly<br />
objects from the Thiersch buildings to visualise the character of<br />
historicist architecture. At the time the documentation, didactics<br />
and aesthetic impact of the objects were kept at the forefront,<br />
there was no funding available for the design of the exhibition<br />
space.<br />
After about twenty exhibitions as guests in other museums<br />
because the <strong>Architektur</strong>museum der TU München had no exhibition<br />
rooms of its own, and another twenty exhibitions with our<br />
involvement that were taken over from other institutions, in September<br />
2002 we were able to present work in our own rooms in<br />
the Pinakothek der Moderne for the first time. In almost all our<br />
exhibitions since 1977, and also in the 42 exhibitions since the<br />
opening of Pinakothek der Moderne, we have largely avoided<br />
presenting architectural drawings and graphic artworks or<br />
paintings as two-dimensional artworks; it has always been a<br />
matter of conveying architectonic and thus ultimately threedimensional<br />
impressions. For that reason, the exhibition room<br />
itself has always been included in the design, although not in the<br />
sense of staging but as spatial design. Architecture in museums,<br />
according to our understanding, means the realisation of threedimensionally<br />
conceived objects in rooms that are designed so<br />
that the objects exhibited, the didactic message conveyed and the<br />
exhibition architecture combine to generate a single whole. The<br />
final consequence of this is that a new form of presentation must<br />
be found or rather developed for every topic and every architect.<br />
And that is precisely what we have done, as each of the exhibitions<br />
has had its own character. This involves considerable planning<br />
effort, as every exhibition is simulated and developed – true<br />
to scale and in every detail – using a model, so that we are able<br />
to anticipate the overall spatial impression it will convey.<br />
A particularly important aspect of such implementation is an<br />
optical and didactic dramaturgy, in a quite literal sense, as exhibitions<br />
always have a stage-like character. Just as, according to<br />
the dramaturgical principle, the actors are reduced and tension<br />
is created to span several acts, the exhibition establishes directions<br />
of viewing and movement, optical accentuations, and<br />
changes of materials, colours or media directly connected to the<br />
content we wish to convey. The structuring of the theme and concentration<br />
on aspects to be grasped are correspondingly decisive.<br />
Conveying content within a limited space and in a form that is<br />
258 <strong>Architektur</strong>museum <strong>Architektur</strong>museum<br />
Wendepunkt(e) im Bauen – Von der seriellen zur digitalen <strong>Architektur</strong> Turning<br />
point(s) of building – From serial to digital architecture Foto: Stefan Paul Stuemer<br />
Die Weisheit baut sich ein Haus – <strong>Architektur</strong> und Geschichte von Bibliotheken<br />
Wisdom Builds her House The Architecture and History of Libraries Foto: Stefan<br />
Müller-Naumann<br />
259