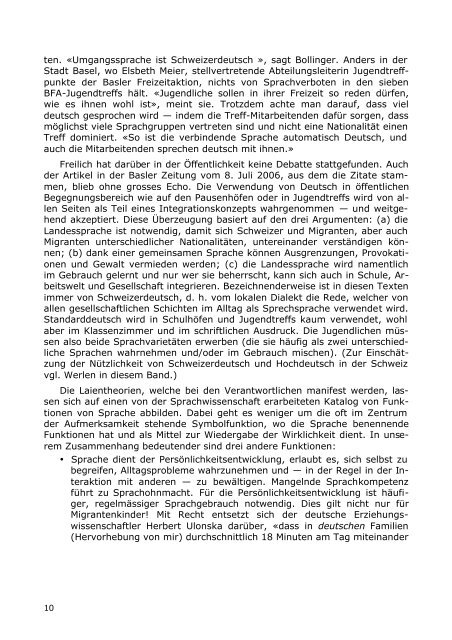Deutsch im Gespräch - Daf Daz Tagung
Deutsch im Gespräch - Daf Daz Tagung
Deutsch im Gespräch - Daf Daz Tagung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ten. «Umgangssprache ist Schweizerdeutsch », sagt Bollinger. Anders in der<br />
Stadt Basel, wo Elsbeth Meier, stellvertretende Abteilungsleiterin Jugendtreffpunkte<br />
der Basler Freizeitaktion, nichts von Sprachverboten in den sieben<br />
BFA-Jugendtreffs hält. «Jugendliche sollen in ihrer Freizeit so reden dürfen,<br />
wie es ihnen wohl ist», meint sie. Trotzdem achte man darauf, dass viel<br />
deutsch gesprochen wird — indem die Treff-Mitarbeitenden dafür sorgen, dass<br />
möglichst viele Sprachgruppen vertreten sind und nicht eine Nationalität einen<br />
Treff dominiert. «So ist die verbindende Sprache automatisch <strong>Deutsch</strong>, und<br />
auch die Mitarbeitenden sprechen deutsch mit ihnen.»<br />
Freilich hat darüber in der Öffentlichkeit keine Debatte stattgefunden. Auch<br />
der Artikel in der Basler Zeitung vom 8. Juli 2006, aus dem die Zitate stammen,<br />
blieb ohne grosses Echo. Die Verwendung von <strong>Deutsch</strong> in öffentlichen<br />
Begegnungsbereich wie auf den Pausenhöfen oder in Jugendtreffs wird von allen<br />
Seiten als Teil eines Integrationskonzepts wahrgenommen — und weitgehend<br />
akzeptiert. Diese Überzeugung basiert auf den drei Argumenten: (a) die<br />
Landessprache ist notwendig, damit sich Schweizer und Migranten, aber auch<br />
Migranten unterschiedlicher Nationalitäten, untereinander verständigen können;<br />
(b) dank einer gemeinsamen Sprache können Ausgrenzungen, Provokationen<br />
und Gewalt vermieden werden; (c) die Landessprache wird namentlich<br />
<strong>im</strong> Gebrauch gelernt und nur wer sie beherrscht, kann sich auch in Schule, Arbeitswelt<br />
und Gesellschaft integrieren. Bezeichnenderweise ist in diesen Texten<br />
<strong>im</strong>mer von Schweizerdeutsch, d. h. vom lokalen Dialekt die Rede, welcher von<br />
allen gesellschaftlichen Schichten <strong>im</strong> Alltag als Sprechsprache verwendet wird.<br />
Standarddeutsch wird in Schulhöfen und Jugendtreffs kaum verwendet, wohl<br />
aber <strong>im</strong> Klassenz<strong>im</strong>mer und <strong>im</strong> schriftlichen Ausdruck. Die Jugendlichen müssen<br />
also beide Sprachvarietäten erwerben (die sie häufig als zwei unterschiedliche<br />
Sprachen wahrnehmen und/oder <strong>im</strong> Gebrauch mischen). (Zur Einschätzung<br />
der Nützlichkeit von Schweizerdeutsch und Hochdeutsch in der Schweiz<br />
vgl. Werlen in diesem Band.)<br />
Die Laientheorien, welche bei den Verantwortlichen manifest werden, lassen<br />
sich auf einen von der Sprachwissenschaft erarbeiteten Katalog von Funktionen<br />
von Sprache abbilden. Dabei geht es weniger um die oft <strong>im</strong> Zentrum<br />
der Aufmerksamkeit stehende Symbolfunktion, wo die Sprache benennende<br />
Funktionen hat und als Mittel zur Wiedergabe der Wirklichkeit dient. In unserem<br />
Zusammenhang bedeutender sind drei andere Funktionen:<br />
10<br />
• Sprache dient der Persönlichkeitsentwicklung, erlaubt es, sich selbst zu<br />
begreifen, Alltagsprobleme wahrzunehmen und — in der Regel in der Interaktion<br />
mit anderen — zu bewältigen. Mangelnde Sprachkompetenz<br />
führt zu Sprachohnmacht. Für die Persönlichkeitsentwicklung ist häufiger,<br />
regelmässiger Sprachgebrauch notwendig. Dies gilt nicht nur für<br />
Migrantenkinder! Mit Recht entsetzt sich der deutsche Erziehungswissenschaftler<br />
Herbert Ulonska darüber, «dass in deutschen Familien<br />
(Hervorhebung von mir) durchschnittlich 18 Minuten am Tag miteinander