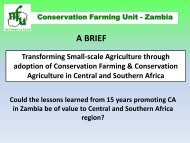Radikale Realpolitik - Rosa Luxemburg Stiftung
Radikale Realpolitik - Rosa Luxemburg Stiftung
Radikale Realpolitik - Rosa Luxemburg Stiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
auf Gestaltung und Regelung menschlicher Verhältnisse weit über »natürliche«<br />
oder spontane Gesellungsformen hinaus einzugehen. Ich kann auf dieser Grundlage<br />
auch Politik nicht nur als einen beständig offenen und gleichsam frei fließenden<br />
diskursiven Prozess begreifen, sondern durchaus auch bestimmte Formen institutionalisierter<br />
Politik konzipieren, aus denen sich zwar im genauen Sinne kein<br />
(moderner) Staat, wohl aber ein politisches Gemeinwesen konstituieren lässt. 16<br />
Damit ergibt sich, dass die Frage nach der spezifischen institutionellen Verfasstheit<br />
von Politik in Partei(en), sozialen Bewegungen oder »zivilgesellschaftlichen«<br />
Netzwerken ebenso grundsätzlich zu untersuchen ist, wie die davon ausgehenden<br />
»Formeffekte« auf verschiedenartige Bündnisse und immer auch auf Initiativen<br />
von Einzelnen und kleinen Gruppen. D. h., die klassisch gewordene Frage »alternativer<br />
Politik« in den 1970er und 1980er Jahren – Wer soll das alles ändern? – ist<br />
auch über strukturelle Transformationen und Übergänge hinweg zu stellen 17 – und<br />
jedenfalls nicht oder nicht in erster Linie personalisierend oder psychologisierend<br />
zu beantworten. D. h., es geht um die Frage nach den institutionellen bzw. organisatorischen<br />
Formen, in denen sich das Subjekt bzw. die Subjektkonstellation der<br />
revolutionären Transformation bzw. eines davon in Gang gebrachten historischen<br />
Überganges konstituieren kann. 18<br />
Als ein erster Problemkomplex drängt sich in diesem Zusammenhang die Frage<br />
nach der relativen Autonomie der institutionell definierten »Politikformen« gegenüber<br />
den primären Prozessen materieller Reproduktion auf – und insbesondere die<br />
Frage, wie weit die Herstellung einer derartigen relativen Autonomie als solche<br />
schon gleichzusetzen ist mit einer wegen ihrer herrschaftlichen Effekte problematischen<br />
Verselbständigung gegenüber einer aktiven Beteiligung der primären Akteure.<br />
19 Darüber hinaus schließt sich daran die weitere Frage an, welche Formen<br />
der Organisierung – d. h. vor allem der Koordinierung und Verstetigung – damit<br />
vereinbar sind, dass weiterhin spontane Initiativen möglich und wichtig bleiben.<br />
Darin liegt m. E. die Problematik mit eingeschlossen, wie überhaupt Prozesse der<br />
Institutionalisierung ganz grundsätzlich zu begreifen sind, d. h. welchen Stellen-<br />
16 Als Philosoph kann ich mich dabei darauf stützen, dass Aristoteles einen Begriff von politischem Gemeinwesen<br />
aus der politischen Wirklichkeit der griechischen Polis herausgelesen hat – lange bevor in der Vorgeschichte des<br />
modernen Staates im Ausgang von Jean Bodin und Niccoló Machiavelli der Begriff des Staates entwickelt worden<br />
ist. Auch ohne dabei die griechische Polis zu idealisieren, lassen sich an der attischen Demokratie (vgl. Neal<br />
Wood; Ellen Meiksins Wood: Class Ideology and Ancient Political Theory. Oxford 1978) bereits einige der Fragen<br />
einer Politik in befreiten Gesellschaften diskutieren – wie dies Hannah Arendt, die ich in anderen Hinsichten<br />
durchaus für elementar kritikwürdig halte – m. E. in durchaus pionierhafter und so weit durchaus vorbildlicher<br />
Weise getan hat.<br />
17 Das hat historisch dazu geführt, dass derartige Fragen in der marxistischen Tradition in erster Linie im Zusammenhang<br />
mit der Debatte über die »Diktatur des Proletariats« als politischer Form eines sozialistischen Übergangs<br />
(vgl. Étienne Balibar: Die Diktatur des Proletariats. Hamburg 1974) artikuliert und diskutiert worden sind.<br />
18 Meine parteipolitischen Erfahrungen liegen in der Vergangenheit der GRÜNEN, meine Bewegungserfahrungen in<br />
Kinderladen-, Anti-Atom und Friedensbewegung, meine theoretischen Bezüge in der Frage nach einer Politik<br />
»diesseits und jenseits« des Staates – daraus versuche ich hier zumindest die ersten Ansatzpunkte für eine derartige<br />
Rekonstruktion der unterschiedlichen Formen von politischer Subjektivität zu gewinnen.<br />
19 Ein analoges Problem wird im Übergang von Hegel zum jungen Marx in der Problematisierung des Verhältnisses<br />
von Entäußerung und Entfremdung artikuliert.<br />
157