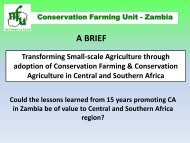Radikale Realpolitik - Rosa Luxemburg Stiftung
Radikale Realpolitik - Rosa Luxemburg Stiftung
Radikale Realpolitik - Rosa Luxemburg Stiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Beispiel des Bildungswesens zeigen lässt. Anders als früher schließt es niemanden<br />
mehr qua sozialer Herkunft aus, aber es trifft mit seinen spezifischen Ausschlussmechanismen<br />
mit brutaler Härte eine soziale Auslese, die der Einzelne als geradezu<br />
schicksalhaft erfährt.<br />
Die gesellschaftlichen Institutionen und Praktiken sind Ergebnis gesellschaftlicher<br />
Praxis und sie strukturieren gesellschaftliche Praxis.<br />
Wie aber ist dieser Zirkel zu durchbrechen? Wie kann, anders gesprochen, die<br />
Spinne die Regeln verändern, nach denen sie das Netz baut, das ihren Aktionsradius<br />
bestimmt?<br />
Lebensplanung, um wieder oben anzuschließen, taucht erst in der modernen<br />
Gesellschaft als allgemeines Phänomen auf. Sie stellt sich dar als Folge von Wahlentscheidungen<br />
des Individuums auf der Grundlage institutioneller »Vorgaben«,<br />
also als relative, durch die gesellschaftlichen Institutionen gesteuerte Freiheit. 6<br />
Wichtiges Element ist z. B. die freie Wahl des Partners, eine kulturelle Praxis, die<br />
noch einmal deutlich jünger ist als die auch nicht besonders alte Institution der<br />
bürgerlichen Ehe. Ein anderes die Ausgestaltung des Bildungsweges durch eigene<br />
Entscheidungen – dabei gesteuert durch das Bildungssystem –, die mit der Freiheit<br />
der Berufswahl zusammenhängt.<br />
Bereits im engen Horizont der Lebensplanung finden sich Begriffe und Probleme<br />
wieder, um die es bei der politischen Willensbildung geht. Lebensplanung<br />
enthält politische Urteile. Sie setzt Stabilität oder Änderung von Institutionen voraus,<br />
sie will mithin auch etwas Politisches.<br />
Eine Lebensplanung, die auf Änderung von Institutionen setzt, nimmt solche<br />
Änderungen bis zu einem gewissen Grad vorweg. Es kommt zu einer Spannung<br />
zwischen dem Leben und den Institutionen. So war es in der Zeit der Veränderungen<br />
in den Sechzigern, einer Zeit, in der in der BRD die bis dahin nahezu unüberwindbar<br />
scheinende christlich-konservative Mehrheit gebrochen wurde. Eine<br />
Bedingung war die Erschütterung der Institution Familie, die ihre Funktion als<br />
Produktionsgenossenschaft verlor und die Lebensplanung der Individuen auf hergebrachte<br />
Weise nicht mehr steuern konnte. Gleichzeitig gab es einen enormen<br />
Schub bei der Erwerbstätigkeit von Frauen außerhalb von Kleingewerbe und Landwirtschaft.<br />
Diese – und weitere – Veränderungen schlugen sich in der Lebenspraxis<br />
und Lebensplanung massenhaft nieder. Die Auffassung: So nicht, so nicht weiter!<br />
ergriff große Teile der Gesellschaft weit über die rebellierende Jugend hinaus<br />
und führte zu gravierenden Änderungen in Partnerschaft, Ehe und Familie. Diese<br />
wiederum führten einige Zeit später, 1976, u. a. schließlich zu einer Liberalisierung<br />
der Ehe- bzw. Scheidungsgesetzgebung.<br />
Bemerkt werden soll in diesem Zusammenhang, dass die Familie gegenwärtig<br />
einen weiteren Funktionsverlust erfährt, nämlich bei der Bildung des Nachwuch-<br />
6 Diesem Widerspruch ging schon Durkheim nach: »Wie geht es zu, dass das Individuum, obgleich es immer autonomer<br />
wird, immer mehr von der Gesellschaft abhängt?« Emile Durkheim: Über soziale Arbeitsteilung. Frankfurt<br />
1999, S. 83.<br />
66