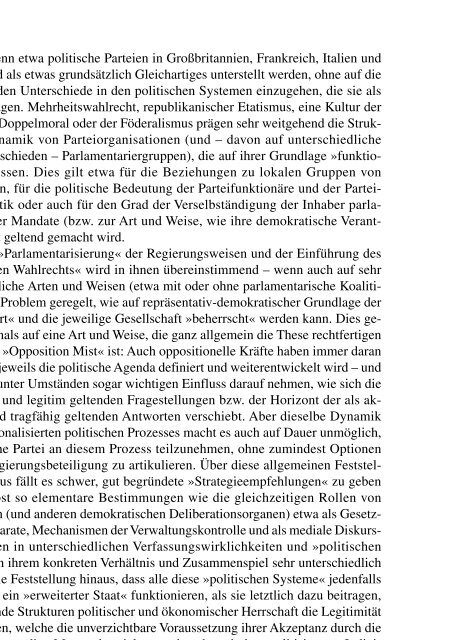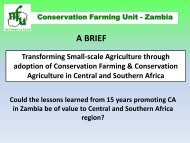Radikale Realpolitik - Rosa Luxemburg Stiftung
Radikale Realpolitik - Rosa Luxemburg Stiftung
Radikale Realpolitik - Rosa Luxemburg Stiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
geboten, wenn etwa politische Parteien in Großbritannien, Frankreich, Italien und<br />
Deutschland als etwas grundsätzlich Gleichartiges unterstellt werden, ohne auf die<br />
tief greifenden Unterschiede in den politischen Systemen einzugehen, die sie als<br />
Parteien prägen. Mehrheitswahlrecht, republikanischer Etatismus, eine Kultur der<br />
politischen Doppelmoral oder der Föderalismus prägen sehr weitgehend die Struktur<br />
und Dynamik von Parteiorganisationen (und – davon auf unterschiedliche<br />
Weise unterschieden – Parlamentariergruppen), die auf ihrer Grundlage »funktionieren«<br />
müssen. Dies gilt etwa für die Beziehungen zu lokalen Gruppen von<br />
Wähler Innen, für die politische Bedeutung der Parteifunktionäre und der Parteiprogrammatik<br />
oder auch für den Grad der Verselbständigung der Inhaber parlamentarischer<br />
Mandate (bzw. zur Art und Weise, wie ihre demokratische Verantwortlichkeit<br />
geltend gemacht wird.<br />
Seit der »Parlamentarisierung« der Regierungsweisen und der Einführung des<br />
»allgemeinen Wahlrechts« wird in ihnen übereinstimmend – wenn auch auf sehr<br />
unterschiedliche Arten und Weisen (etwa mit oder ohne parlamentarische Koalitionen)<br />
– das Problem geregelt, wie auf repräsentativ-demokratischer Grundlage der<br />
Staat »regiert« und die jeweilige Gesellschaft »beherrscht« werden kann. Dies geschieht<br />
niemals auf eine Art und Weise, die ganz allgemein die These rechtfertigen<br />
würde, dass »Opposition Mist« ist: Auch oppositionelle Kräfte haben immer daran<br />
Anteil, wie jeweils die politische Agenda definiert und weiterentwickelt wird – und<br />
sie können unter Umständen sogar wichtigen Einfluss darauf nehmen, wie sich die<br />
als relevant und legitim geltenden Fragestellungen bzw. der Horizont der als akzeptabel<br />
und tragfähig geltenden Antworten verschiebt. Aber dieselbe Dynamik<br />
des institutionalisierten politischen Prozesses macht es auch auf Dauer unmöglich,<br />
als politische Partei an diesem Prozess teilzunehmen, ohne zumindest Optionen<br />
auf eine Regierungsbeteiligung zu artikulieren. Über diese allgemeinen Feststellungen<br />
hinaus fällt es schwer, gut begründete »Strategieempfehlungen« zu geben<br />
– denn selbst so elementare Bestimmungen wie die gleichzeitigen Rollen von<br />
Parlamen ten (und anderen demokratischen Deliberationsorganen) etwa als Ge setzgebungsapparate,<br />
Mechanismen der Verwaltungskontrolle und als mediale Dis kursarenen<br />
fallen in unterschiedlichen Verfassungswirklichkeiten und »politischen<br />
Kulturen« in ihrem konkreten Verhältnis und Zusammenspiel sehr unterschiedlich<br />
aus. Über die Feststellung hinaus, dass alle diese »politischen Systeme« jedenfalls<br />
insofern als ein »erweiterter Staat« funktionieren, als sie letztlich dazu beitragen,<br />
für bestehende Strukturen politischer und ökonomischer Herrschaft die Legitimität<br />
zu generieren, welche die unverzichtbare Voraussetzung ihrer Akzeptanz durch die<br />
»Massen«, bzw. die »Menge der vielen« mehr oder minder »politisier ten« Individuen,<br />
bildet. Insofern lassen sich auch etwa parlamentarische Parteien – und zwar<br />
in allen ihren heute, unter der Voraussetzung von Parla men tari sierung und allgemeinem<br />
Wahlrecht, vorzufindenden oder sich noch entfaltenden Varianten – als<br />
»ideologische Staatsapparate« analysieren. Das sollte allerdings nicht dahingehend<br />
missverstanden werden, dass fälschlich unterstellt wird, dass gewisse, in der<br />
161