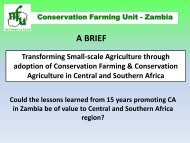Radikale Realpolitik - Rosa Luxemburg Stiftung
Radikale Realpolitik - Rosa Luxemburg Stiftung
Radikale Realpolitik - Rosa Luxemburg Stiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Klaus Lederer<br />
Was ist und was kann »radikale <strong>Realpolitik</strong>« heute?<br />
Eine Diskussion über die Erfahrungen und Möglichkeiten einer »revolutionären<br />
<strong>Realpolitik</strong>« oder »radikalen <strong>Realpolitik</strong>« unter den Bedingungen des Kapitalismus<br />
im 21. Jahrhundert führt einmal mehr auf eines der grundlegenden Probleme<br />
linker Parteipolitik – insbesondere derjenigen, die in parlamentarischer Verantwortung<br />
und erst recht in Regierungskoalitionen stattfindet. Denn nimmt man <strong>Rosa</strong><br />
<strong>Luxemburg</strong>s Unterscheidung einer »revolutionären <strong>Realpolitik</strong>« von einer bürgerlichen<br />
Politik ebenso wie von einem »revolutionär-sozialistischen Utopismus«<br />
zum Ausgangspunkt, so geht es zunächst um die Einsicht in die – beziehungsweise<br />
die Erkenntnis der – realen Verhältnisse und ihrer Bewegungsformen, der Bestimmung<br />
der eigenen Rolle und Stellung innerhalb dieser Verhältnisse und um die<br />
Reflektion des eigenen politischen Tuns, seiner Wirkungen und Folgen. <strong>Rosa</strong> hat<br />
das in der ihr eigenen Knappheit so ausgedrückt: »Mit dem Ariadnefaden der<br />
Marxschen Lehre in der Hand ist die Arbeiterpartei heute die einzige, die vom historischen<br />
Standpunkt weiß, was sie tut, und deshalb tut, was sie will.« 1 Fehlt uns<br />
heute auch die Sicherheit historischer Determinismen, so ist und bleibt an <strong>Rosa</strong><br />
dieser Aspekt faszinierend aktuell: dass linke »radikale Politik« kein beliebiges<br />
Schaukeln zwischen den vorhandenen Interessen und Triebkräften ist ohne jeden<br />
Bezug zum gesellschaftsverändernden Anspruch, sondern ein insoweit bewusstes<br />
Handeln im Wissen um die eigenen Möglichkeiten, Grenzen und Widersprüche<br />
konkreter Situationen.<br />
Eine solche kritische Reflexion des eigenen politischen Tuns setzt neben einem<br />
Grundbestand theoretischen Instrumentariums 2 aber auch die Gelegenheiten dazu<br />
voraus. Diese Gelegenheiten sind vor dem Hintergrund der Anforderungen des politischen<br />
Alltagsgeschäftes, denen man als Parteifunktionär und Parlamentarier unterliegt,<br />
rar gesät. Zumal wenn eine Einladung wie die zu unserem heutigen Workshop<br />
mitten in die politische Saison platzt. Deshalb möchte ich gleich eingangs<br />
um Nachsicht dafür bitten, dass so mancher Gedanke, den ich hier heute darlege,<br />
der hohen Messlatte analytischen Herangehens, die <strong>Rosa</strong> uns vorgibt, nicht in vollem<br />
Umfang genügen wird. Auch ist, mit Rücksicht auf Zeitpläne und die Möglich-<br />
1 <strong>Rosa</strong> <strong>Luxemburg</strong>: Karl Marx. In: <strong>Rosa</strong> <strong>Luxemburg</strong>, Gesammelte Werke Bd.1/2, S. 369, 371 (Kursivsetzung im<br />
Original).<br />
2 Dieser Aspekt wird im Weiteren nur am Rande gestreift. Es muss gewiss in Zweifel gezogen werden, dass es in<br />
Hinblick auf die moderne Annäherung an die Analyse unserer Gesellschaft einen common sense im linken theoretischen<br />
Diskurs gäbe. Das Defizit ist erklärbar. Nicht erklärbar ist angesichts des Defizits die vergleichsweise geringe<br />
Breite einer offenen Diskussion ohne Vorfestlegungen bzw. ohne Tabubereiche bei der Kritik des Marxismus-Leninismus<br />
als orthodoxer Verengung und Legitimationsideologie.<br />
69