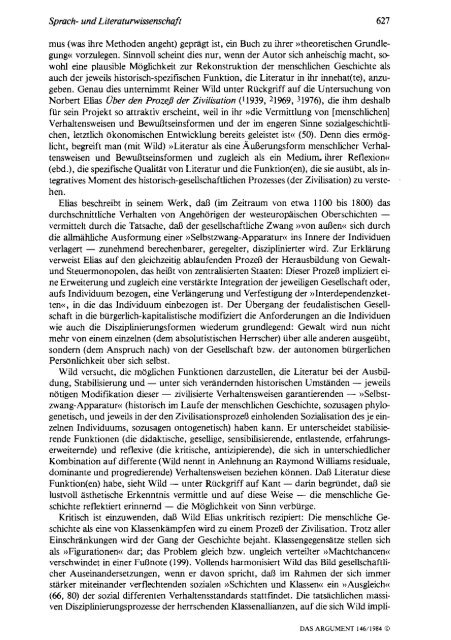das argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
das argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
das argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sprach- und Literaturwissenschaft 627<br />
mus (was ihre Methoden angeht) geprägt ist, ein Buch zu ihrer »theoretischen Grundlegung«<br />
vorzulegen. Sinnvoll scheint dies nur, wenn der Autor sich anheischig macht, sowohl<br />
eine plausible Möglichkeit zur Rekonstruktion der menschlichen Geschichte als<br />
auch der jeweils historisch-spezifischen Funktion, die Literatur in ihr innehat(te), anzugeben.<br />
Genau dies unternimmt Reiner Wild unter Rückgriff auf die Untersuchung von<br />
Norbert Elias Über den Prozeß der Zivilisation ('1939, 21%9, 31976), die ihm deshalb<br />
für sein Projekt so attraktiv erscheint, weil in ihr »die Vermittlung von [menschlichen]<br />
Verhaltensweisen und Bewußtseinsformen und der im engeren Sinne sozialgeschichtlichen,<br />
letztlich ökonomischen Entwicklung bereits geleistet ist« (50). Denn dies ermöglicht,<br />
begreift man (mit Wild) »Literatur als eine Äußerungsform menschlicher Verhaltensweisen<br />
und Bewußtseinsformen und zugleich als ein Medium. ihrer Reflexion«<br />
(ebd.), die spezifische Qualität von Literatur und die Funktion(en), die sie ausübt, als integratives<br />
Moment des historisch-gesellschaftlichen Prozesses (der Zivilisation) zu verstehen.<br />
Elias beschreibt in seinem Werk, daß (im Zeitraum von etwa 1100 bis 1800) <strong>das</strong><br />
durchschnittliche Verhalten von Angehörigen der westeuropäischen Oberschichten -<br />
vermittelt durch die Tatsache, daß der gesellschaftliche Zwang »von außen« sich durch<br />
die allmähliche Ausformung einer »Selbstzwang-Apparatur« ins Innere der Individuen<br />
verlagert - zunehmend berechenbarer, geregelter, disziplinierter wird. Zur Erklärung<br />
verweist Elias auf den gleichzeitig ablaufenden Prozeß der Herausbildung von Gewaltund<br />
Steuermonopolen, <strong>das</strong> heißt von zentralisierten Staaten: Dieser Prozeß impliziert eine<br />
Erweiterung und zugleich eine verstärkte Integration der jeweiligen Gesellschaft oder,<br />
aufs Individuum bezogen, eine Verlängerung und Verfestigung der »Interdependenzketten«,<br />
in die <strong>das</strong> Individuum einbezogen ist. Der Übergang der feudalistischen Gesellschaft<br />
in die bürgerlich-kapitalistische modifiziert die Anforderungen an die Individuen<br />
wie auch die Disziplinierungsformen wiederum grundlegend: Gewalt wird nun nicht<br />
mehr von einem einzelnen (dem absolutistischen Herrscher) über alle anderen ausgeübt,<br />
sondern (dem Anspruch nach) von der Gesellschaft bzw. der autonomen bürgerlichen<br />
Persönlichkeit über sich selbst.<br />
Wild versucht, die möglichen Funktionen darzustellen, die Literatur bei der Ausbildung,<br />
Stabilisierung und - unter sich verändernden historischen Umständen - jeweils<br />
nötigen Modifikation dieser - zivilisierte Verhaltensweisen garantierenden - »Selbstzwang-Apparatur«<br />
(historisch im Laufe der menschlichen Geschichte, sozusagen phylogenetisch,<br />
und jeweils in der den Zivilisationsprozeß einholenden Sozialisation des je einzelnen<br />
Individuums, sozusagen ontogenetisch) haben kann. Er unterscheidet stabilisierende<br />
Funktionen (die didaktische, gesellige, sensibilisierende, entlastende, erfahrungserweiternde)<br />
und reflexive (die <strong>kritische</strong>, antizipierende), die sich in unterschiedlicher<br />
Kombination auf differente (Wild nennt in Anlehnung an Raymond Williams residuale,<br />
dominante und progredierende) Verhaltensweisen beziehen können. Daß Literatur diese<br />
Funktion(en) habe, sieht Wild - unter Rückgriff auf Kant - darin begründet, daß sie<br />
lustvoll ästhetische Erkenntnis vermittle und auf diese Weise - die menschliche Geschichte<br />
reflektiert erinnernd - die Möglichkeit von Sinn verbürge.<br />
Kritisch ist einzuwenden, daß Wild Elias unkritisch rezipiert: Die menschliche Geschichte<br />
als eine von Klassenkämpfen wird zu einem Prozeß der Zivilisation. Trotz aller<br />
Einschränkungen wird der Gang der Geschichte bejaht. Klassengegensätze stellen sich<br />
als »Figurationen« dar; <strong>das</strong> Problem gleich bzw. ungleich verteilter »Machtchancen«<br />
verschwindet in einer Fußnote (199). Vollends harmonisiert Wild <strong>das</strong> Bild gesellschaftlicher<br />
Auseinandersetzungen, wenn er davon spricht, daß im Rahmen der sich immer<br />
stärker miteinander verflechtenden sozialen »Schichten und Klassen« ein »Ausgleich«<br />
(66, 80) der sozial differenten Verhaltensstandards stattfmdet. Die tatsächlichen massiven<br />
Disziplinierungsprozesse der herrschenden Klassenalliartzen, auf die sich Wild impli-<br />
DAS ARGUMENT 146/1984 ©