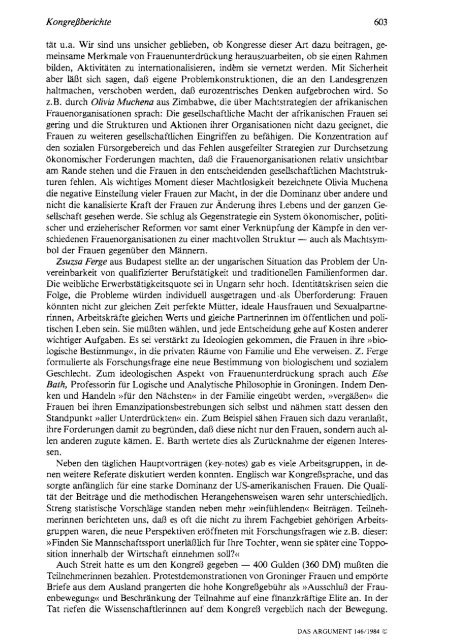das argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
das argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
das argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kongreßberichte 603<br />
tät u.a. Wir sind uns unsicher geblieben, ob Kongresse dieser Art dazu beitragen, gemeinsame<br />
Merkmale von Frauenunterdrückung herauszuarbeiten, ob sie einen Rahmen<br />
bilden, Aktivitäten zu internationalisieren, indem sie vernetzt werden. Mit Sicherheit<br />
aber läßt sich sagen, daß eigene Problemkonstruktionen, die an den Landesgrenzen<br />
haltmachen, verschoben werden, daß eurozentrisches Denken aufgebrochen wird. So<br />
z.B. durch Olivia Muchena aus Zimbabwe, die über Machtstrategien der afrikanischen<br />
Frauenorganisationen sprach: Die gesellschaftliche Macht der afrikanischen Frauen sei<br />
gering und die Strukturen und Aktionen ihrer Organisationen nicht dazu geeignet, die<br />
Frauen zu weiteren gesellschaftlichen Eingriffen zu befähigen. Die Konzentration auf<br />
den sozialen Fürsorgebereich und <strong>das</strong> Fehlen ausgefeilter Strategien zur Durchsetzung<br />
ökonomischer Forderungen machten, daß die Frauenorganisationen relativ unsichtbar<br />
am Rande stehen und die Frauen in den entscheidenden gesellschaftlichen Machtstrukturen<br />
fehlen. Als wichtiges Moment dieser Machtlosigkeit bezeichnete Olivia Muchena<br />
die negative Einstellung vieler Frauen zur Macht, in der die Dominanz über andere und<br />
nicht die kanalisierte Kraft der Frauen zur Änderung ihres Lebens und der ganzen Gesellschaft<br />
gesehen werde. Sie schlug als Gegenstrategie ein System ökonomischer, politischer<br />
und erzieherischer Reformen vor samt einer Verknüpfung der Kämpfe in den verschiedenen<br />
Frauenorganisationen zu einer machtvollen Struktur - auch als Machtsymbol<br />
der Frauen gegenüber den Männern.<br />
Zsuzsa Ferge aus Budapest stellte an der ungarischen Situation <strong>das</strong> Problem der Unvereinbarkeit<br />
von qualifIzierter Berufstätigkeit und traditionellen Farnilienformen dar.<br />
Die weibliche Erwerbstätigkeitsquote sei in Ungarn sehr hoch. Identitätskrisen seien die<br />
Folge, die Probleme würden individuell ausgetragen und ,als Überforderung: Frauen<br />
könnten nicht zur gleichen Zeit perfekte Mütter, ideale Hausfrauen und Sexualpartnerinnen,<br />
Arbeitskräfte gleichen Werts und gleiche Partnerinnen im öffentlichen und politischen<br />
Leben sein. Sie müßten wählen, und jede Entscheidung gehe auf Kosten anderer<br />
wichtiger Aufgaben. Es sei verstärkt zu Ideologien gekommen, die Frauen in ihre »biologische<br />
Bestimmung«, in die privaten Räume von Familie und Ehe verweisen. Z. Ferge<br />
formulierte als Forschungsfrage eine neue Bestimmung von biologischem und sozialem<br />
Geschlecht. Zum ideologischen Aspekt von Frauenunterdrückung sprach auch Else<br />
Bath, Professorin für Logische und Analytische Philosophie in Groningen. Indem Denken<br />
und Handeln »für den Nächsten« in der Farnilie eingeübt werden, »vergäßen« die<br />
Frauen bei ihren Emanzipationsbestrebungen sich selbst und nähmen statt dessen den<br />
Standpunkt »aller Unterdrückten« ein. Zum Beispiel sähen Frauen sich dazu veranlaßt,<br />
ihre Forderungen damit zu begründen, daß diese nicht nur den Frauen, sondern auch allen<br />
anderen zugute kämen. E. Barth wertete dies als Zurücknahme der eigenen Interessen.<br />
Neben den täglichen Hauptvorträgen (key-notes) gab es viele Arbeitsgruppen, in denen<br />
weitere Referate diskutiert werden konnten. Englisch war Kongreßsprache, und <strong>das</strong><br />
sorgte anfänglich für eine starke Dominanz der US-amerikanischen Frauen. Die Qualität<br />
der Beiträge und die methodischen Herangehensweisen waren sehr unterschiedlich.<br />
Streng statistische Vorschläge standen neben mehr »einfühlenden« Beiträgen. Teilnehmerinnen<br />
berichteten uns, daß es oft die nicht zu ihrem Fachgebiet gehörigen Arbeitsgruppen<br />
waren, die neue Perspektiven eröffneten mit Forschungsfragen wie z.B. dieser:<br />
»Finden Sie Mannschaftssport unerläßlich für Ihre Tochter, wenn sie später eine Topposition<br />
innerhalb der Wirtschaft einnehmen soll?«<br />
Auch Streit hatte es um den Kongreß gegeben - 400 Gulden (360 DM) mußten die<br />
Teilnehmerinnen bezahlen. Protestdemonstrationen von Groninger Frauen und empörte<br />
Briefe aus dem Ausland prangerten die hohe Kongreßgebühr als »Ausschluß der Frauenbewegung«<br />
und Beschränkung der Teilnahme auf eine fmanzkräftige Elite an. In der<br />
Tat riefen die WissenschaftIerinnen auf dem Kongreß vergeblich nach der Bewegung.<br />
DAS ARGUMENT 146/1984 ©