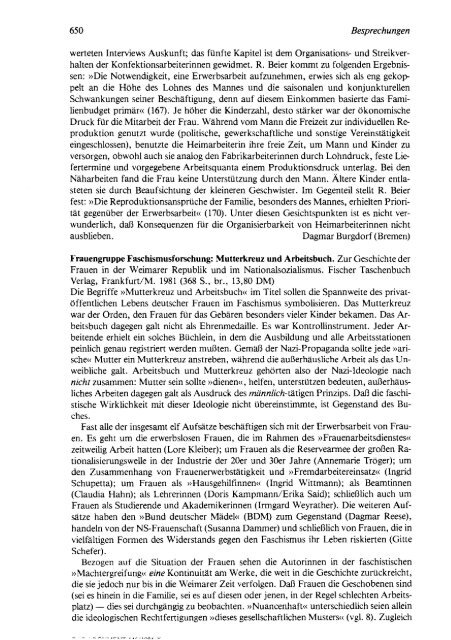das argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
das argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
das argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
650 Besprechungen<br />
werteten Interviews Auskunft; <strong>das</strong> fünfte Kapitel ist dem Organisations- und Streikverhalten<br />
der Konfektionsarbeiterinnen gewidmet. R. Beier kommt zu folgenden Ergebnissen:<br />
»Die Notwendigkeit, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen, erwies sich als eng gekoppelt<br />
an die Höhe des Lohnes des Mannes und die saisonalen und konjunkturellen<br />
Schwankungen seiner Beschäftigung, denn auf diesem Einkommen basierte <strong>das</strong> Farnilienbudget<br />
primär« (167). Je höher die Kinderzahl, desto stärker war der ökonomische<br />
Druck für die Mitarbeit der Frau. Während vom Mann die Freizeit zur individuellen Reproduktion<br />
genutzt wurde (politische, gewerkschaftliche und sonstige Vereinstätigkeit<br />
eingeschlossen), benutzte die Heimarbeiterin ihre freie Zeit, um Mann und Kinder zu<br />
versorgen, obwohl auch sie analog den Fabrikarbeiterinnen durch Lohndruck, feste Lieferterrnine<br />
und vorgegebene Arbeitsquanta einem Produktionsdruck unterlag. Bei den<br />
Näharbeiten fand die Frau keine Unterstützung durch den Mann. Ältere Kinder entlasteten<br />
sie durch Beaufsichtung der kleineren Geschwister. Im Gegenteil stellt R. Beier<br />
fest: »Die Reproduktionsansprüche der Familie, besonders des Mannes, erhielten Priorität<br />
gegenüber der Erwerbsarbeit« (170). Unter diesen Gesichtspunkten ist es nicht verwunderlich,<br />
daß Konsequenzen für die Organisierbarkeit von Heimarbeiterinnen nicht<br />
ausblieben.<br />
Dagmar Burgdorf (Bremen)<br />
Frauengruppe Faschismusforschung: Mutterkreuz und Arbeitsbuch. Zur Geschichte der<br />
Frauen in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Fischer Taschenbuch<br />
Verlag, Frankfurt/M. 1981 (368 S., br., 13,80 DM)<br />
Die Begriffe »Mutterkreuz und Arbeitsbuch« im Titel sollen die Spannweite des privatöffentlichen<br />
Lebens deutscher Frauen im Faschismus symbolisieren. Das Mutterkreuz<br />
war der Orden, den Frauen für <strong>das</strong> Gebären besonders vieler Kinder bekamen. Das Arbeitsbuch<br />
dagegen galt nicht als Ehrenmedaille. Es war Kontrollinstrument. Jeder Arbeitende<br />
erhielt ein solches Büchlein, in dem die Ausbildung und alle Arbeitsstationen<br />
peinlich genau registriert werden mußten. Gemäß der Nazi-Propaganda sollte jede »arische«<br />
Mutter ein Mutterkreuz anstreben, während die außerhäusliche Arbeit als <strong>das</strong> Unweibliche<br />
galt. Arbeitsbuch und Mutterkreuz gehörten also der Nazi-Ideologie nach<br />
nicht zusammen: Mutter sein sollte »dienen«, helfen, unterstützen bedeuten, außerhäusliches<br />
Arbeiten dagegen galt als Ausdruck des männlich-tätigen Prinzips. Daß die faschistische<br />
Wirklichkeit mit dieser Ideologie nicht übereinstimmte, ist Gegenstand des Buches.<br />
Fast alle der insgesamt elf Aufsätze beschäftigen sich mit der Erwerbsarbeit von Frauen.<br />
Es geht um die erwerbslosen Frauen, die im Rahmen des »Frauenarbeitsdienstes«<br />
zeitweilig Arbeit hatten (Lore Kleiber); um Frauen als die Reservearmee der großen Rationalisierungswelle<br />
in der Industrie der 20er und 30er Jahre (Annemarie Tröger); um<br />
den Zusammenhang von Frauenerwerbstätigkeit und »Fremdarbeitereinsatz« (Ingrid<br />
Schupetta); um Frauen als »Hausgehilfinnen« (lngrid Wittmann); als Beamtinnen<br />
(Claudia Hahn); als Lehrerinnen (Doris KampmanniErika Said); schließlich auch um<br />
Frauen als Studierende und Akademikerinnen (Irmgard Weyrather). Die weiteren Aufsätze<br />
haben den »Bund deutscher Mädel« (BDM) zum Gegenstand (Dagmar Reese),<br />
handeln von der NS-Frauenschaft (Susanna Dammer) und schließlich von Frauen, die in<br />
vielfaltigen Formen des Widerstands gegen den Faschismus ihr Leben riskierten (Gitte<br />
Schefer).<br />
Bezogen auf die Situation der Frauen sehen die Autorinnen in der faschistischen<br />
»Machtergreifung« eine Kontinuität am Werke, die weit in die Geschichte zurückreicht,<br />
die sie jedoch nur bis in die Weimarer Zeit verfolgen. Daß Frauen die Geschobenen sind<br />
(sei es hinein in die Familie, sei es auf diesen oder jenen, in der Regel schlechten Arbeitsplatz)<br />
- dies sei durchgängig zu beobachten. »Nuancenhaft« unterschiedlich seien allein<br />
die ideologischen Rechtfertigungen »dieses gesellschaftlichen Musters« (vgl. 8). Zugleich