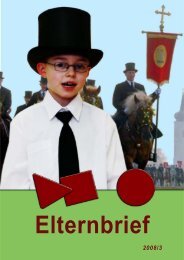Witaj und 2plus - Sorbischer Schulverein e.V.
Witaj und 2plus - Sorbischer Schulverein e.V.
Witaj und 2plus - Sorbischer Schulverein e.V.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
falschen Alternative – Spracherhaltungsmodelle<br />
versus bilingualer two-way-Modelle<br />
hinauskommen kann – dann nämlich, wenn<br />
wir beobachten, dass – ganz im Sinne des<br />
Kontinuums der Sprachen – Spracherhalt<br />
<strong>und</strong> Bilingualismus sich nicht gegenüberstehen,<br />
sondern bedingen, sprich die sorbisch<br />
sprechenden Kinder sich sehr erfolgreich<br />
weiterentwickeln, wenn sie mit deutschsprachigen<br />
Kindern gemeinsam lernen.<br />
Ergebnisse aus der wissenschaftlichen<br />
Begleitung<br />
der sorbisch-deutschen<br />
Gr<strong>und</strong>schulen<br />
Zunächst sei ein Blick auf die sprachliche<br />
Heterogenität der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
in den sorbisch-deutschen Gr<strong>und</strong>schulen<br />
geworfen:<br />
Abb. 1: Familiärer Sprachgebrauch<br />
Familienfest<br />
in Ralbitz<br />
Wie Abb. 1 zeigt, stellt diese eine Herausforderung<br />
für die Institution Schule dar, sollen<br />
in den bilingualen Klassen doch alle im Diagramm<br />
vertretenen Sprachgruppen in beiden<br />
Sprachen adäquat gefördert werden. Es ist zu<br />
erkennen, dass zwischen den Polen «nur Sorbisch»<br />
bzw. «nur Deutsch» eine Reihe von<br />
Zwischenformen des familiären Sprachgebrauchs<br />
zu beobachten sind. Soll eine «aktive<br />
sorbisch-deutsche Zweisprachigkeit» in der<br />
Region als globale Zielkategorie der <strong>2plus</strong>-<br />
Konzeption in Sachsen mittelfristig realisiert<br />
werden, so gilt es, die deutschsprachigen<br />
Kinder während der Gr<strong>und</strong>schulzeit an die<br />
sorbische Sprache heranzuführen, während<br />
die dominant sorbischsprachigen Kinder die<br />
Balance ihrer Zweisprachigkeit beibehalten,<br />
sprich: Die muttersprachlich sorbischen Kinder<br />
sollen auch im zweisprachigen Unterrichtsmodell<br />
die sorbische Sprache nicht nur<br />
als Medium der alltäglichen Kommunikation<br />
verwenden, sondern die Sprache auf hohem<br />
‹bildungsprachlichen› Niveau beherrschen.<br />
Dies ist nicht zuletzt im Hinblick auf einen<br />
Erhalt der sorbischen Sprache als einem vollwertig<br />
ausgebauten Kommunikationsmedium<br />
(vgl. Kloss 1978) von großer Bedeutung.<br />
Welche vorläufigen Tendenzen lassen sich in<br />
diesem Zusammenhang aus den bisherigen<br />
Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitung<br />
erkennen? Dazu zunächst einige Anmerkungen<br />
zur Vorgehensweise: Es wurden<br />
zu Beginn <strong>und</strong> gegen Ende des ersten Schuljahres<br />
mündliche Sprachproben von insgesamt<br />
123 Kindern, die sich auf sieben Projektklassen<br />
verteilen, mittels Bildimpulsen<br />
auf Deutsch <strong>und</strong> Sorbisch erhoben. Diese<br />
Aufnahmen wurden zunächst in Sachsen<br />
transkribiert <strong>und</strong> mittels eines Auswertungsbogens<br />
einer ersten qualitativen Auswertung<br />
zugeführt. In Köln <strong>und</strong> Hamburg wurden im<br />
Anschluss daran statistische Analysen zu verschiedenen<br />
sprachlichen Teilbereichen durch-